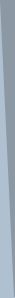 |

Reise des Orgelbaumeisters Oskar Walcker nach Bessarabien
Rom. Ende November. In der ewigen Stadt fing es schon stark an zu herbsteln. Aber immer noch saßen die Menschen vor den Cafes auf der Straße. Nur die Nächte waren kühl geworden. Die Aufstellung der Orgel im St. Petersdom zu Rom war beendet. Ich hatte den Auftrag erhalten, mich ungesäumt nach Bessarabien zu begeben, um in der deutschen Kolonie Fere-Champenoise eine neue Orgel aufzustellen. Ich sah auf der Karte nach, auf welchem Breitengrad Bessarabien liegt, um mir ungefähr ein Bild machen zu können, wie kalt es in dieser Gegend sein kann. Nur wenige Breitengrade nördlicher als Rom konnte die Kälte nicht übergroß sein. Ich sollte mich schwer täuschen. Meine Kleidung war mehr auf die warme Sonne Italiens eingestellt als auf die Kälte der russischen Steppe. Immerhin war mir klar, dass ich mit meinem leichten Sommerüberzieher nicht auskommen würde und erstand mir einen Havelock mit großem Radmantel aus Loden. Mein Hut schien völlig zu genügen. Und dann besaß ich noch einen eleganten Regenschirm mit einem Stöckchen bleistiftdick, auf dessen Besitz ich nicht wenig stolz war.
Der Weg führte mich über den Balkan und Rumänien nach Russland hinein. Kein Mensch konnte mir sagen, wo dieses Fere-Champenoise eigentlich liege. Noch weniger, wie es zu erreichen sei, so fuhr ich denn zuerst nach Odessa, hoffend, dort die nötige Auskunft zu erhalten. In dieser Stadt besuchte ich meinen alten Freund und Landsmann Viktor Feyerabend, der mich gastlich aufnahm und mich abends noch in die Familie meiner zukünftigen Frau einführte. Dort erhielt ich ausgiebige Auskunft über den Weg, den ich einzuschlagen hatte.
Am andern Tag ging es weiter mit dem Bummelzug. Mit 20 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreichte ich schließlich Leipzgskaja an der Bender-Galatzer Bahn gelegen. Von dort war der Weg mit den Schlitten zurück zu legen. Es war bitter kalt, tiefer Schnee bedeckte die Steppe. Das Thermometer war unter 20 Grad gesunken. Leipzigskaja! Ein typisch dreckiger russischer Bahnhof, die Luft stark mit Juchtenduft erfüllt, ein großer Platz vor der Station, von kleinen, einstöckigen Gebäuden umgeben. Ein paar Dutzend Schlitten standen im Schnee, die bärtigen Iswostschiks mit ihren blauen, wattierten Mänteln, die hohe Pelzmütze auf dem Kopf, standen verschlafen herum. Nun ging der Handel los. Keiner wollte nach Fere-Champenoise fahren. Es sei zu weit, die Nacht breche herein usw. Endlich wurde ich doch mit einem Juden handelseinig. Es war gegen mittags drei Uhr geworden.
Nach russischer Sitte genehmigte ich mir in der Bahnhofswirtschaft einen Wodka und aß einige Piroggen dazu. Im Raum Zigarettenwolken, einige Bauern auf Reisen mit großem Gepäck (der russische Bauer pfleg , wenn er sich auf Reisen begibt, seine Betten mitzunehmen). Das Büffet im allgemeinen reich besetzt., Fische aller Art, Kaviar, auch auf der unansehn- lichsten Station. An Schmutz kein Mangel, stiefeldick lagert er auf allen Dingen, aber immerhin, der Schnaps schmeckt und die Brötchen werden mit Genuß verzehrt.
Aber nun hinaus in die bitter kalte Luft. Ich verstaute den Koffer in dem kleinen, engen Schlitten so gut es ging, fürsorglich auf meinen Re-genschirm bedacht und hüllte mich in meine Pelerine. Der Fuhrmann gab mir noch zwei dreckige Pferdedecken dazu, die einen unangenehmen Geruch ausstrahlten und los gings in die Schneelandschaft hinein. Der Weg war nicht zu erkennen. Ich hatte den Eindruck, der Mann fährt instinktiv seiner Nase nach. Kein Baum, kein Strauch, kein Haus ragte aus der endlosen Schneewüste heraus. Die Nacht brach herein, ein Schneesturm hatte sich eingestellt. Ich fror trotz Mantel und Decken unheimlich und konnte mich kaum mehr rühren. Ein Windstoß und mein feines Hütchen war dahin, ihm nachzujagen war eine Unmöglichkeit. Der Fuhrmann meinte, wir kämen bald in ein Dorf, wo er versuchen wollte, mir eine Kopfbedeckung zu beschaffen. Einige Bauern wurden herausgeklopft und ich erhielt endlich gegen eine gute Bezahlung eine alte, hohe Pelzmütze, die ich mir jetzt wenigstens über die Ohren ziehen konnte. Auf Läuse habe ich sie nicht untersucht.
Unbegreiflich, wie der Mann den Weg fand. Wir kamen schließlich gegen zehn Uhr abends in Fere- Champenoise an und klopften den Schulmeister aus dem Schlaf. Ich war so bocksteif zusammengefroren, dass man mich aus dem Schlitten herausheben mußte. Da es in diesen Steppendörfern weder Wirtshäuser noch sonstige Unterkunftsmöglichkeiten gab, der Schulmeister natürlich kein Gastzimmer hatte, wurde mir auf dem Ofen ein Lager hergerichtet, in dem ich wieder einigermaßen auftauen konnte.
Am andern Morgen war die erste Sorge, mir ein Unterkommen zu verschaffen. Dieses fand ich auch bei einem Bauern, der mich gastfrei aufnahm. In der Mitte des Hauses war ein riesiger, etwa vier Quadratmeter großer Ofen, der die aus zwei Räumen bestehende Wohnung wärmte. Geheizt wurde der Ofen mit Mist, der im Sommer in kleine Holzkistchen gepresst und getrocknet wird. Man kann sich den unangenehmen Geruch vorstellen, der die Wohnung erfüllte. Von Holzboden ist natürlich keine Rede, der Fußboden besteht aus gestampftem Lehm. Das Bodenputzen ist
sehr einfach. Etwas feiner, frischer Sand wird gestreut und fertig ist die Laube. Passiert den Kindern etwas Menschliches, so ist mit einer Hand voll Sand der Schaden schnell behoben.
Die Familie bestand aus dem Ehepaar und zwei Kindern. Der eine Raum diente als Schlafzimmer, die Kinder lagen in einer Kiste, die Eltern in einem primitiven Bett. Für mich wurde eine Art Kiste ins gleiche Zimmer gestellt, mit Stroh gefüllt und ein paar Decken vervollständigten die Lagerstatt. Ich habe darin jedoch immer glänzend geschlafen, ohne von Wanzen besonders gestört zu werden. Von der Kultur wenig beleckt, genierte man sich nicht voreinander, ging zusammen zur Ruhe und stand zusammen auf.
Der andere Raum diente als Wohnraum. Die Möbelausstattung war denkbar einfach. Auf einer hölzernen Schranne saßen der Bauer und ich zu den Mahlzeiten, das Eintopfgericht zwischen den Knien, ein Tisch war nicht vorhanden. Die Frau saß mit den Kindern auf niederen Schemeln, vor sich eine zweite Bank, die als Tisch genutzt wurde. Die Speisekarte war wenig abwechslungsreich: morgens ein Brei, mittags ein undefinierbares Gemüse. Der Bauer und ich bekamen einen mit Pferdemist geräucherten Gänseschlegel in die Hand; von dem ich mit Genuß herunterbiß. Abends gab es eine Art Grütze. Zu jeder Mahlzeit holte der Bauer eine Flasche Rotwein, den er Schnaps nannte, eigenes Gewächs. Dieser wurde in Gläsern kredenzt, die, wenig gespült, ihren roten Weinschimmer behielten.
Die Orgelkisten standen schon in der Kirche, die Arbeit begann. Die Kirche war nicht heizbar und hundekalt. Die Metallteile blieben einem beinahe an der Hand kleben, und doch mussten die Bleirohre eingezogen werden. Das Schulhaus befand sich gegenüber der Kirche, so dass ich wenigstens von Zeit zu Zeit Gelegenheit hatte, mich aufzuwärmen und heißen Tee einzunehmen. Abends kamen dann beim Schulmeister der Schulze und die Honoratioren des Dorfes zusammen, um bei einem Glas Wein mit mir zu plaudern. Ich mußte von Deutschland, der alten Heimat und von meinen Reisen erzählen, andererseits hörte ich viel vom Leben in der russischen Steppe, von dem Betrieb der Landwirtschaft, vom Weinbau, von der Ernte u.a.m.
Die Gemeindeverfassung dieser Dörfer ist einfach. Der Schulmeister ist zugleich auch der Dorfschreiber. Der Schulze, ein Bauer, ist Ehrenbeamter. Dann zwei weitere Ehrenämter, die im Turnus alle paar Monate wechselten. Der „Sozke“, der die Polizeigewalt inne hatte und der „Sezke“, der den Gemeindeprügelmeister spielt. Beide treten selten in Aktion. Eigentlich nur dann, wenn sich herumtreibendes Gesindel im Dorfe zeigt. Die Polizeistrafen sind ebenso einfach, sollen aber eine ausgezeichnete Wirkung haben. Wenn ein Delinquent erwischt wird, kommt er ins „Loch“. Neben dem Gemeindezimmer ist ein kleiner Raum mit wenige Mobiliar, eine lange Bank, an jedem Bein ein starker Riemen. Darauf werden die unliebsamen Elemente angeschnallt. An der Wand hängt eine neun- schwänzige Peitsche, und nun waltet der „Sezke“ seines Amtes. Es wurde mir versichert, dass es noch nie vorgekommen sei, dass einer, der diese Prozedur ausgekostet habe, sich je wieder im Dorfe gezeigt habe.
Der schwarze Erdboden ist außerordentlich fruchtbar, so salpeterhaltig, dass das Grundwasser und der aus ihm bereitete Tee nach Salpeter schmeckten. Der Boden wird kaum bearbeitet, von Düngen keine Rede. Man lässt da und dort die Ernte überreif werden, die ausfallenden Körner sind dann der Samen für die nächste Ernte. Das Schneiden der Frucht ist die Hauptarbeit. Das Getreide wird in großen Haufen, um die ein Seil gelegt ist, vom Pferd übers Feld nach dem Dorf gezogen und in einem großen Kreis geschichtet. Das Dreschen geht rasch vor sich. Vor einen etwa einen Meter langen und 40 cm dicken, gerippten Stein wird ein Pferd gespannt und so lange gefahren, bis die Körner den Halmen entfallen sind. Vom Regen allein hängt der Ausfall der Ernte ab.
Auch Weinbau erfordert keine besondere Sorgfalt. Ein Reis in den Boden gesteckt wächst zur Rebe heran, die notdürftig an einen Stock gebunden wird. Die Reben wurden von den Kolonisten aus der alten Heimat mitgebracht, so dass man heute noch an der Art des Weines feststellen kann, ob die Kolonisten von Württemberg oder von der Pfalz seinerzeit eingewandert sind. Im Frühjahr durchziehen jüdische Händler das Land, um den Bauern den Wein zu einem Spottpreis abzukaufen.
Die Orgel wurde fertig, gefiel den Leuten und ich rüstete mich zur Abreise. Immer noch trug ich die hohe Pelzmütze des bessarabischen Bauern. Der Pfarrer, der sich meiner erbarmte, schenkte mir eine seiner Pelzmützen, so dass ich wenigstens wieder einigermaßen ordentlich in die Stadt Odessa einziehen konnte.
Da verschiedene andere Gemeinden des Landes neue Orgeln beschaffen wollten, entschloß ich mich, noch einige Orte zu besuchen.
Es hatte sich herumgesprochen, dass in der Steppe ein Filzhut gefunden worden sei. Kein Mensch konnte sich denken, wo dieser Filzhut hergekommen sei und so gelang es mir, wieder in den Besitz meines Hutes zu kommen.
In der Kolonie Paris wurde ich freundlich empfangen. Abends fand im Schulhaus mir zu Ehren ein Konzert statt, ein Kunstgenuß ohnegleichen. Die deutschen Bauernsöhne wurden meistens in russische Militärkapellen gesteckt, lernten dort irgendein Instrument spielen und diese Leute bilden dann da und dort die Dorfkapelle.
In der Kolonie Beresina kam ich abends an. Die Leute freuten sich sehr, dass sich wieder einmal ein Fremder zu ihnen verirrte. In der Schule versammelte sich eine Menge Leute, denen ich dann von der alten Heimat erzählen mußte. Auf meine Frage, wo ich schlafen könne, lud mich der Schulze ein, mit ihm zu kommen. Zuerst gabs ein feudales Mahl, dann wurde ich in ein Zimmer geführt, wo schon eine Anzahl Personen schliefen. Der Schulze erklärte mir, dass in dem einen Bett sein Sohn und seine Schwiegertochter schliefen, in dem anderen die Schwiegermutter, einige Kinder seien auch noch da. Ich selbst erhielt eine Art Sofa mit ein paar Decken als Lagerstatt. Die andern waren morgens etwas erstaunt, einen Fremdling unter sich begrüßen zu können.
Dann gings nach Tarutino, dem Marktflecken der Gegend. Beim Schulmeister wurde ich einquartiert. Der Schlafraum wurde durch einen Vorhang abgeteilt. Während der Nacht hörte ich Röcheln und Stöhnen. Als ich am andern Morgen hinter den Vorhang sah, lag ein junges Mädchen mit vom Fieber blaurot gefärbtem Gesicht. Wie ich hörte, war sie an schwerem Typhus erkrankt. Ich erinnerte mich des Pfarrers von Fere – Champenoise, der mir bei meiner Abreise eine Anzahl Chininpulver mitgab und mir empfahl, diese von Zeit zu Zeit zu nehmen, der Typhus herrsche zur Zeit im Lande. Ich zog es vor, aus dem Schulhaus zu verschwinden, nicht ohne dem Schulmeister meinen schönen, feingegliederten Schirm, den er besonders bewunderte, zu dedizieren.
Das Reisen in der Steppe ist nicht ganz einfach. In jedem Dorf hat ein Bauer abwechselnd den Postdienst und ist verpflichtet, den Reisenden bis ins nächste Dorf zu befördern, wo man wieder den Postbauern aufsuchen muss, um weiterbefördert zu werden. In Tarutino mußte ich noch zwei Tage bleiben, es wurde mir einfach kein Fuhrwerk gestellt. Dort genoß ich herzliche Gastfreundschaft. Da die Leute schlechte Keller hatten, wurden die Weinflaschen in den Sand gegraben. Wenn dann dieser Wein bei besonderer Gelegenheit ausgegraben wird, gibt's, wie ich selbst verspüren konnte, herrliche Tropfen.
In Odessa angekommen, erholte ich mich einige Tage von den Strapazen der Steppe, besuchte einen Ball in der deutschen Gesellschaft, dann ging es über die Bukowina und Galizien wieder der Heimat zu.
Auszug aus den Reiseerinnerungen des Orgelbaumeisters Reinhold Link.
Im Jahre 1911 reiste der Orgelbaumeister Reinhold Link aus Giengen an der Brenz, Württemberg, nach Südrussland, um in dem deutschen Dorf Michaelstal (Woronzowka) eine Kirchenorgel in der kleinen Kirche aufzubauen. Er besuchte noch zwei weitere deutsche Dörfer in der Umgebung. Olgenfeld, wo er eine Bestellung für eine Orgel annahm und Ruhetal, das unweit von Olgenfeld gelegen war.
Diese Dörfer sind typisch für die vielen Tochterkolonien, die im ganzen russischen Riesenreich verstreut seit hundert Jahren gegründet worden waren. Es waren bis zur Revolution weit über 2 000 Dörfer an der Zahl.
Zweihundert Mutterkolonien waren die ersten deutschen Kolonien, die in Südrussland von deutschen Einwanderern, eingeladen von Zar Alexander I. mit seinem Manifest, ab dem Jahre 1904 gegründet worden waren. Nach großen Schwierigkeiten in dieser Gründungszeit trat schon nach zwei Generationen eine gewisser Wohlstand ein, der es den Gebietsämtern der verschiedenen Siedlungsgebiete, in denen die Dörfer zusammengefaßt waren, ermöglichte, überall in Russland Land aufzukaufen und es den Nachkommen der ersten Siedler zur Verfügung zu stellen. Sie waren schon dadurch zu dieser Maßnahme gezwungen, weil der Kinderreichtum der deutschen Bauern enorm groß war und nur auf diese Weise konnte das dadurch entstandene sog. Landlosenproblem gelöst werden.
Inmitten einer fremden Umgebung und in den meisten Fällen praktisch ohne Verbindung zur Außenwelt entstanden so Gemeinwesen einfacher Art und in den meisten Fällen nicht zu vergleichen mit den ursprünglichen Mutterkolonien, in Größe wie in Bedeutung.
Dieser umfangreiche Bericht des Orgelbaumeisters Link ist somit durch seine objektive Detailgenauigkeit ein einzigartiges Dokument, das in seiner Einmaligkeit Einblick in die Lebensweise der Menschen in diesen oft einsamen Gebieten ermöglicht.
Ich fand diesen Bericht so faszinierend, als ich ihn erhielt, so daß ich mich freue, ihn jetzt an dieser Stelle einer größeren Öffentlichkeit vorstellen zu können. Leider ist mir nicht bekannt, wo dieser Bericht erschienen ist. Ich forsche weiter.
Unser „Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e. V.“ hat im Jahre 2001 ein bemerkenswertes Buch von Ulrich Mertens mit dem Titel „ Handbuch Russlanddeutsche“ herausgebracht, in dem fast alle deutschen Dörfer in Russland überraschend detailgenau beschrieben sind.
Über die drei im Text vorkommenden Dörfer steht darin folgendes:
Michaelstal (Woronzowka),
Kaukasus/Donskoi/Jeisk Gegr.1853, ev. An der Ostküste des Asowschen Meeres. Erste Riebensdorfer Tochterkolonie, 30 Fam. (1860); Sowjetsitz, Agro-Kooperativkolchos, Schule, Lesehalle (1926) Einwohner: (1904 680, (1909) 680, (1918) 680
(1926) 1 030
Olgenfeld (Popowa/Schibbeliwka)
Don/Rostow/Otradowka. Gegr. 1866/69, ev. 80 km SW von Rostow. 14 Gründerfamilien aus Michaelstal/Donezk und Riebensdorf kauften das Gut Sch.; Schule Sowjetsitz, zus. mit Ruhental: Viehzucht-Kolchos, Saatgutkolchos (1926) Einwohner: 539 (1904) 456 (1926)
Ruhental (Rebbiwka –Chutor/Ruhetal
Gegr. 1861,1866,1869. ev. 80 km SW von Rostow. Gründerfamilien aus Michaelstal und von der Molotschna kauften das Gut Rebbiwka; Schule Kolchos s. Olgenfeld
Gerhard Walter
Bei deutschen Siedlern in Südrussland.
Gegen Abend erhob sich leider ein mächtiger Sturm und ich befürchtete mit Recht, dass in schroffem Gegensatz zu der herrlichen Reise über das Schwarze Meer die letzte Teilstrecke, die Überquerung des Asowschen Meeres, einen nicht gerade angenehmen Verlauf nehmen würde, hauptsächlich in Anbetracht der wenig einladenden Eigenschaft des „Donez“, welchem ich mich für diese Fahrt anvertrauen sollte. Es war ein erbärmlicher, gebrechlicher uralter Kasten, nicht größer als ein Bodenseedampfer, den die Gesellschaft, welche die Ehre hat, ihn ihr Eigentum zu nennen, wahrscheinlich vor 20 oder 30 Jahren irgendwo auf den Abbruch kaufte.

Nun, die Überfahrt dauert ja nicht lange, eben eine Nacht, so lange hoffte ich schon durchzuhalten. Außer mir waren als Mitreisende nur noch zwei Viehhändler an Bord mit einer stattlichen Menge lebender Fracht, deren ängstliches Brüllen sich mit dem Heulen und Brausen des Sturmes zu einer nichts weniger als verlockenden Musik vermischte.
Nachdem ich mir durch die auf dem Hauptdeck Ochsen und Kühen einen Weg gebahnt hatte, gelangte ich über eine enge, steile und finstere Treppe in den „Salon“ und Schlafgemach zugleich vorstellenden Raum „1. Klasse“, ein ganz am Bug des Schiffes liegendes, kleines Loch ohne Licht und Luft. In der Mitte stand ein Tisch und an den Wänden entlang lief eine als Lagerstätte dienende ledergepolsterte zweistöckige Bank. Angefüllt war der ganze Raum mit jenem echt russischen Dunst, der dem Nicht-Halbasiaten schon bei normalen Zuständen Übelkeit verursachen muß. Aan der Decke hing eine trübe, qualmende und stinkende Erdölfunzel, die jedes Restchen von frischer Luft, welches sich etwa hierher verirren würde, vollends verzehrte. Lange hielt ich es hier nicht aus, sondern begab mich, da ein Aufenthalt auf dem Hauptdeck wegen der hier sich dicht drängenden Viehherde unmöglich war, auf das kleine obere Deck. Gewaltig heulte und brauste der Sturm, doch glücklicherweise regnete es zunächst nicht. Dröhnend schlugen die Wogen an meinen „Donez“ empor, dass er in allen Fugen erzitterte, ächzte und stöhnte, wie wenn er selbst Angst hätte, sich aus dem schützenden Hafen in dieses Toben hinauszuwagen.

Es war schon finstere Nacht, als die Höllenfahrt endlich losging. Gleichzeitig mit unserem „Donez“ fuhr ein grösserer, anderer Dampfer aus. Dieser schien infolge des Sturmes aus dem Kurs zu kommen, wenigstens bemerkte ich, dass er rasch immer mehr drehte und mit dem Heck auf uns zutrieb, was merkwürdigerweise niemand von den beiderseitigen Schiffsbemannungen zu beachten schien. Es dauerte denn auch nicht lange, bis ein Zusammenprall erfolgte. Der „Donez“ war in die Seite getroffen und einige an dieser Stelle überhängende Rettungsboote wurden heruntergerissen und stürzten krachend in die Tiefe, wo sie zwischen den beiden Schiffskörpern zermalmt wurden. Glücklicherweise hatte dies den Stoß etwas gemildert und unser „Donez“ keine ernsthafte Beschädigung, sondern nur einige Schrammen erlitten, so dass die Fahrt, nachdem die mit dem Schiff noch zusammenhängenden Trümmer vollends losgemacht worden waren, fortgesetzt werden konnte.
Der Sturm nahm immer mehr zu, weshalb das Segeldach des oberen Decks eingeholt wurde, um nicht fortgerissen zu werden. Ich sah mich dadurch veranlasst, es doch wieder unten zu versuchen und in die „1. Klasse“ hinabzusteigen. Jedoch es war nicht auszuhalten. Ich nahm daher eines der ausgestopften ledernen Kopfpolster und meinen Mantel, um trotz des Sturmes auf dem oberen Deck ein Lager aufzuschlagen. Eine geschützte Stelle hoffte ich schon zu finden. Aber, oh welches Pech, inzwischen hatte ein wolkenbruchartiger Regen eingesetzt, der mich zwang, hinabzusteigen. Doch es ging mit dem besten Willen nicht, ich glaube, ich wäre da unten gestorben. Die Seekrankheit überfiel mich mit einer Heftigkeit, wie ich sie nie zuvor kennengelernt hatte. Ich musste wieder an die Luft. Nachdem kein schützendes Dach mehr da war, blieb mir nichts anderes übrig, als unter einer der festgeschraubten Sitzbänke einigermaßen Schutz gegen den Regen und die Gewalt des Windes zu suchen. Dafür aber erwischten mich die Spritzwellen und überkommende Sturzseen um so gründlicher. Es war ein ganz trostloser Zustand und ich hätte es, wie dies bekanntlich bei heftiger Seekrankheit allgemein der Fall ist, tatsächlich als Erlösung empfunden, wenn mich eine Sturzwelle mitgenommen und über Bord gespült hätte, damit dieser qualvolle Zustand ein Ende nähme und ich verwünschte den Entschluß, trotz dem Unwetter die kurze Fahrt über das Asowsche Meer statt der allerdings sehr zeitraubenden und umwegigen Landreise ab Mariupol gewählt zu haben. Unser „Donez“ tanzte wie eine Nussschale auf den rasenden Wellen. Nie im Leben werde ich diese fürchterlichste Nacht, die ich jemals auf dem Meere erlebte, vergessen.
Sterbenselend, bis auf die Haut durchnässt und zitternd vor Kälte, begab ich mich, nachdem der Sturm gegen Morgen endlich etwas abgeflaut war, in den Maschinenraum hinab und legte mich neben die beiden Reisegefährten, denen es auch nicht besser ergangen war als mir, dicht bei den Maschinen in Schmutz und Schmiere auf den Boden, um wenigstens wieder etwas trocken zu werden.
Auch diese bösen Stunden gingen vorüber und ich dankte Gott, als bei Morgengrauen Land in Sicht kam.
Immer noch mehr tot als lebendig infolge der durchgemachten, schweren Seekrankheit betrat ich in Jeijsk um etwa 7 Uhr morgens wieder das feste Land, wie schon so manches Mal mir fest vornehmend, nie mehr auf das Wasser zu gehen.
Wie gerädert wankte ich zur nächsten Droschke, um zum Hotel „Bristol“ zu fahren, das mir schon vorher als Absteigeort der Bewohner der deutschen Siedlung Woronzowka, dem Ziel meiner Reise, genannt worden war. Ich kann nicht behaupten, dass das Geholper über das bucklige Pflaster bei meinem schmerzenden Leib gerade ein besonderer Genuß gewesen wäre.
Das Hotel Bristol schien meilenweit entfernt zu sein. Endlich, nach einer langen halben Stunde war ich dort. Vor allem wurde ein starker Tee genehmigt, um den verrenkten Magen wieder einigermaßen einzurichten und die aufgewühlten Eingeweide zu besänftigen.
Meine Hoffnung, dass der Besitzer des Gasthofes oder irgend ein anwesender Gast deutsch verstünde, erfüllte sich leider nicht. Ich suchte daher dem Wirt so gut es ging, begreiflich zu machen, dass ich nach Woronzowka wollte. Er erwiderte etwas auf russisch, das natürlich ich nicht wieder nicht verstehen konnte. Es war Markttag und ein fortwährendes Kommen und Gehen in der Wirtschaft, sowie auf der Straße ein lebhaftes Hin und Her von Troikas (russisches Dreigespann) und allen anderen möglichen ländlichen Fuhrwerken.
Immer wieder wandte ich mich an den Wirt mit dem Wort „Woronzowka“ und jedes Mal machte er eine beschwichtigende Geste, die bedeuten sollte, geduldig zu warten.
So verging der Vormittag, bis mir endlich gegen Mittag bedeutet wurde, dass unweit des Gasthofes das Fuhrwerk eines deutschen Siedlers aus Woronzowka eingetroffen sei. Ich eilte auf die Straße, um den Landsmann zu begrüßen. Er freute sich sehr, den schon seit mehreren Tagen erwarteten Orgelbauer in Woronzowka einliefern zu können und bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal in seinem Leben einen „deutschen“ Deutschen zu sehen,, denn es kommt vielleicht nur alle fünfzig Jahre einmal vor, dass ein Reichsdeutscher sich in ein deutsches Dorf in Südrussland verirrt.
Nachdem er seine Geschäfte, die ihn hierher führten, erledigt hatte, bestieg ich seine flotte Troika und in lustigem Trab ging es der etwa 20 Kilometer entfernten deutschen Siedlung Woronzowka zu. Glühend heiß brannte die Sonne auf die ausgedörrte Steppe herab und ich war froh, als ich nach insgesamt sechzehntägiger Reise an meinem Bestimmungsort angelangt war.
Fünf Wochen in südrussischen Siedlungen
Der erste Eindruck, den ich von Woronzowka bekam, war ein überaus einladender. Freundliche, massive Häuser leuchteten im Sonnenglanz auf, ein wohltuender Gegensatz zu den unsäglich schmutzigen und armseligen russischen Dörfern und beim Betreten dieser Siedlung sieht einem überall ein unverkennbarer Wohlstand entgegen.
Ich wurde bei einem der größten Gutsbesitzer Woronzowkas, der zugleich auch Ortsschulze war, als Gast aufgenommen, denn, wie allgemein in Russland in kleineren Ortschaften, so gibt es auch in den deutschen Dörfern keinerlei Gasthöfe oder Herbergen. Solche sind in Russland auch nicht nötig, da die Gastfreundschaft dort in außerordentlich weitgehendem Maße ausgeführt wird. Nicht nur Verwandte und Freunde, sondern jeder völlig Fremde, der einen geordneten und anständigen Eindruck macht, wird in jedem einigermaßen besseren Haus, wo er anklopft, ohne weiteres eine zeitlang unentgeltlich verpflegt. Ich fühlte mich denn auch trotz der ungewohnten Umgebung dank der herzlichen Aufnahme gleich von der ersten Stunde an ganz heimisch.
Sehen wir uns nun zuerst unser Woronzowka näher an. Die ganze Ortschaft besteht aus etwa fünfzig bis sechzig großen Bauernhöfen, die sich in einfacher Reihe zu beiden Seiten der mächtigen, mindestens 25 Meter breiten Hauptstraße und weniger kurzer Querstraßen hin erstrecken. Natürlich sind dies keine Straßen in unserem Sinn, sondern eben der von zahllosen Fahrspuren durchfurchte Erdboden, der bei trockenem Wetter sehr staubig ist, bei Regen dagegen sich in einen noch unangenehmeren Dreck verwandelt. Hinter den üblichen Vorgärten erheben sich, die Längsseite meistens der Straße zugekehrt, die ausnahmslos einstöckigen, jedoch breiten, sehr solid aus Ziegelsteinen und mit auffallend starken Mauern erbauten, häufig in hübschem Landhausstil gehaltenen, weiß oder bunt verputzten Wohnhäuser.
Seitlich stößt gewöhnlich der den Hof gegen die Straße abschließende gemauerte große Torbogen an.
Der Eingang zum Wohnhaus ist stets von der hinteren, also der Hofseite aus. Über ein paar Stufen gelangen wir zur Haustüre und dann in einen großen, dielenartigen Vorraum, der im Sommer der ganzen Familie als Wohnstube dient und den wir in verschieden großen Abmessungen in jedem Haus antreffen. Anstoßend an diese Diele liegen die Wohnzimmer und die Winterküche. Die Wohnhäuser sind durchweg sehr geräumig, die Räume hoch und luftig. Die Öfen, große, vom Flur aus geheizte porzellanene Kachelöfen sind so eingebaut, dass ein Ofen gleichzeitig mehrere Zimmer erwärmt. Die Ausstattung der Zimmer ist überaus einfach, aller unnötige Luxus oder überflüssiger Tand ist vermieden.
Um den Innenhof gruppieren sich die landwirtschaftlichen Gebäude, die aber für deutsche Begriffe unverhältnismäßig klein erscheinen, jedoch trotzdem vollkommen genügen, da das ganze Getreide bis zu dem stets auf dem freiem Felde erfolgenden Drusch im Feld draußen aufgestapelt wird. Auch Ställe sind nicht in dem Maße vorhanden, wie der Viehbestand es vermuten ließe, weil dessen größter Teil die meiste Zeit des Jahres über im freien Feld weidet und nur während des Winters auf einige Monate hereingeholt und in bloß überdachten, sonst offen Schuppen untergebracht wird. Nur die für den Landwirtschaftsbetrieb erforderlichen Pferde und die für den täglichen Milchbedarf nötige Anzahl Kühe werden auf dem Hof selbst gehalten, jedoch größtenteils ebenso wie auch die Schweine, jeden Morgen auf die Weide getrieben, weshalb die Futtervorräte für das Vieh auch nur unbedeutend zu sein brauchen. An Haustieren finden wir ganz dieselben wie bei uns, besonders groß ist der Reichtum an Pferden, an Hornvieh und an Schweinen, dagegen werden Schafe, Ziegen oder Hasen wenig gehalten.
Die eigentliche Hauptküche liegt im Hof. Sie besteht aus einem meist in der Nähe des Wohnhauses aus Ziegelsteinen aufgemauerten Herd mit einer Überdachung. Solange die Witterung es irgendwie gestattet, wird hier gekocht und nur im Winter und in einzelnen Ausnahmefällen die Winterküche benutzt. Letztere dient auch zugleich als Hausmolkerei, Waschküche, Rumpelkammer und als Schlafraum für Mägde, deren nur aus Unterbett und Deckbett bestehende Lager tagsüber zusammengepackt und in einer Ecke des Raumes zusammengelegt werden.
Im Hof befinden sich außerdem noch die Ziehbrunnen, einer mit gewöhnlichem Grundwasser für das Vieh, für Haushaltzwecke, Wäsche usw., und einer mit aufgefangenem Regenwasser für den menschlichen Gebrauch. Bäche oder gar Quellen gibt es in dieser Gegend nicht, in welchem sich Ackerfeld oder Steppe sich hunderte von Kilometern topfeben hinziehen, in welchem kein Schatten spendendes Gesträuch, geschweige denn noch so kleines Gehölz ein Restchen des vom Himmel gefallenen köstlichen Nasses aufspeichert. Und Wasserleitung ist natürlich etwas völlig Unbekanntes. Man ist lediglich auf das von der Dachrinne durch ein Rohr in den Brunnenschacht abgeleitete Regenwasser angewiesen. Daß dieses manchmal für europäische Begriffe als von recht zweifelhafter Güte erscheint, braucht wohl kaum besonders erwähnt zu werden, aber der Mensch gewöhnt sich glücklicherweise an alles. Hauptsächlich die große Hitze lehrt einen, auch solches Wasser zu trinken, aus dem man vorher ein paar ertrunkene Käfer, Fliegen, Schneckchen oder sonstiges totes Getier herausgefischt hat.
Anschließend an den Hof erstreckt sich häufig ein Gärtchen, in welchem das Gemüse für den häuslichen Bedarf wie Kohl, Gurken, Tomaten, welche alle drei in Russland eine viel wichtigere Rolle spielen als bei uns, gezogen werden und in dem sich auch meistens einige, infolge der im Sommer monatelang andauernden Hitze halbverdorrte und verkümmerte Apfel – Pflaumen – und Aprikosenbäume befinden. Am Ende des Dorfes erhebt sich die schlichte, einfache Dorfkirche, welche, wie der sie umgebende Friedhof, einen durchaus heimatlichen Eindruck macht.
Doch kehren wir nach diesem Rundgang wieder zum Wohnhaus meines liebenswürdigen Gastgebers, Tobias Michailowitsch Semke, zurück. Meine Ankunft hatte sich natürlich sehr schnell herumgesprochen und schon hatte sich inzwischen eine Anzahl Nachbarn und Freunde des Hauses eingefunden, denn es ist begreiflich, dass mein Eintreffen in Woronzowka ein ganz ungewöhnliches Ereignis bedeutete. Und nun musste ich erzählen, wie ich gereist und wie lange ich unterwegs war, was ich auf der Reise erlebte usw. Als es sich herausstellte, dass ich nicht russisch kann, erregte dies allgemeines Erstaunen und einigen war es geradezu unbegreiflich, wie ich mit meinem recht bescheidenen russischen Wortschatz in diese weltentlegene Gegend hergefunden habe. Gegen Abend kamen dann auch die erwachsenen Söhne und Töchter des Hauses vom Feld heim und mit jedem durfte, oder beinahe richtiger, musste ich nach russischer Sitte ein Schnäpschen auf gegenseitiges Wohl trinken, so dass es mir fast des Guten zuviel wurde, bis sie alle beieinander waren.
Zum Abendessen versammelte sich die ganze, überaus zahlreiche Familie um den riesigen Esstisch auf der Diele. Nachher –noch weitere Nachbarn hatten sich nach und nach zugesellt – ging es wieder ans Plaudern. Mit seltenen Ausnahmen kennen die deutschen Siedler das Vaterland ihrer Vorfahren nur vom Hörensagen. Sie leben in tiefster Weltabgeschiedenheit und können sich keinen richtigen Begriff von Deutschland und überhaupt davon machen, wie es in der Welt zugeht, da ja die meisten von ihnen kaum weiter als in die benachbarte Stadt Jeisk und selbst nur wenige in die etwas entferntere Kreisstadt Rostow gekommen sind und es umgekehrt Jahrzehnte dauern kann, bis einmal ein Fremder, geschweige denn gar ein Reichsdeutscher, in eine deutsche Gemeinde in dieser weltentlegenen Gegend verschlagen wird. Ich konnte daher meinen andächtig lauschenden Woronzowkaern gleich am ersten Tag nicht genug erzählen von unserem Vaterland, seinen Bewohnern, deren Sitten und Gebräuchen, ihren sozialen Verhältnissen und sonstigen Lebensumständen, von den Schul – und Militärverhältnissen, von unserem, von ihnen hochverehrten Kaiser und anderem mehr.
Denn noch ist die Liebe zur alten Heimat der Väter nicht geschwunden, sondern hat sich vererbt auf Kinder und Kindeskinder, und nicht nur einmal wurde , wenn ich in den folgenden Tagen abends im trauten Kreis mit ein paar Nachbarn zusammensaß, der Wunsch laut, lieber in Deutschland zu sein anstatt hier unter den den deutschen Bauern ihres Besitzes wegen neidischen, missgünstigen, ja sogar feindlichen Russen leben zu müssen. Allerdings hatten unsere guten Landsleute eine ganz übermäßig ideale Meinung und Vorstellung von allem, was deutsch ist und deutsch heißt, von der deutschen Kultur und Zivilisation, von der Bildungsstufe, Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit des deutschen Volkes und ich begegnete manchem ungläubigen Lächeln, ja sogar manchem offen ausgesprochenen Zweifel, wenn ich auf diesbezügliche Fragen ehrlicherweise sagen musste, dass in Deutschland auch betrogen und gestohlen, bestochen, ja sogar geraubt und gemordet werde. Wenn auch nicht so viel wie in Russland, so doch immer mehr als genug. Oder wenn ich darauf hinwies, wie teuer in Deutschland alles sei im Vergleich zu ihrer Heimat und wie hart der deutsche Bauer im Gegensatz zu ihnen um sein tägliches Brot zu kämpfen habe infolge der viel ungünstigeren Boden – und Klimaverhältnisse in Deutschland, und dass man in Deutschland stramm Steuer zu zahlen habe, wenn diese auch gewöhnlich nicht mit solch rücksichtslosen und gewalttätigen Mitteln eingetrieben werden wie bei ihnen in Russland.
So ward aus Morgen und Abend der erste Tag und es ging schon auf Mitternacht, als ich mein Lager aufsuchte und zu der nach der ungemütlichen Meerfahrt wohlverdiente Ruhe gehen konnte.
Über die Umgebung Woronzowkas lässt sich nicht viel sagen. Nach drei Richtungen hinaus dehnt sich schier unendlich, durch kein Gebüsch, keinen Baum belebtes, höchstens von einzelnen, im Sommer fast ausgetrockneten schilfüberwucherten Sumpftümpeln unterbrochenes, flaches oder leicht welliges Land, das als Getreidefeld bebaut ist oder als Brachland zur Viehweide dient. Zwischendurch ziehen sich 20, 30 Meter breit, die öden, staubigen, bei Regenwetter bodenlos schmutzigen Fahrspuren hin, welche die nicht einmal sehr weit von einander entfernten deutschen Siedlungen und Russendörfer verbinden. Wege oder gar Straßen gibt es in Russland nur zwischen einzelnen großen Städten, weitab von den Hauptverkehrslinien überhaupt keine. Man fährt eben quer durch Acker und Steppe, und wo einst der Erste gefahren ist, fährt der Nächste und Übernächste, bis eben nach und nach eine Wegstrecke entsteht. Gegen Westen hinaus erstreckt sich, nur etwa einen Kilometer von Woronzowka entfernt, der Strand einer Bucht des Asowschen Meeres, welches seine während der warmen Jahreszeit sehr übelriechenden, schmutzigbraunen, schlammigen und zu einem Bad wenig einladenden Wellen mit ziemlich großer Heftigkeit über den sumpfigen Untergrund heranrollt. Die Küste in diesem Gebiet steigt zwischen fünf und fünfzehn Meter senkrecht auf. Die schwarze, weiche und vollkommen steinlose Erde neigt ungemein zur Entstehung von Rissen, welche, begünstigt durch die oft lang anhaltende Trockenheit, sich rasch vergrößern und vertiefen, so dass ganze, mehrere Meter lange und bis zu einem halben Meter dicke Erdmauern sich abspalten und sich beim geringsten Anlaß infolge Wellenschlages oder Winddrucks ins Meer umstürzen und es ist zu verlockend und unterhaltend, mit einem kräftigen Fußtritt oder mittels dem Spazierstock bei großen Wänden der Natur ein bisschen nachzuhelfen, dass sie mit lautem Getöse in die Wellen hinunterklatschen. Auf diese Weise frisst das Meer Jahr für Jahr gierig auf einer Strecke von hundert Kilometern einige Meter von der Küste weg und nähert das Ufer sich immer mehr der Ortschaft, so dass es sich heute schon ungefähr voraussagen lässt, wann das erste Haus dem Meer zum Opfer fällt, wenn nicht rechtzeitig Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden. Es wird sogar unausbleiblich sein, dass mit der Zeit die ganze Ortschaft im Meer verschwindet, doch dies hat noch eine gute Weile. Landschaftliche Reize sucht man in dieser Gegend vergeblich und nach ein paar Wochen Aufenthalts sehnt man sich ordentlich nach einer grünen Wiese und noch mehr nach dem Wald, den mal als Deutscher besonders vermisst.
Nun einiges über unsere Landsleute selbst. Wie die Vorfahren fast all der vielen, auf eineinhalb Millionen geschätzten deutschen Bauern in Südrussland, insbesondere im Kuban- Don – und Kaukasusgebiet, an der Wolga und auf der Halbinsel Krim, so sind auch die Ahnen der Bewohner von Woronzowka ums Jahr 1768 und zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts aus der deutschen Heimat, hauptsächlich gerade aus unserem Schwabenland, ausgewandert, um sich in Russland eine neue Heimat zu gründen, was sie auch fast ausnahmslos erreichten. Außerordentlich wohlfeiles Land, sehr fruchtbare, völlig steinfreie Erde, billige russische Arbeitskräfte und Dienstboten wirkten mit, dass Fleiß, Tüchtigkeit und Sparsamkeit der eingewanderten reichlich belohnt wurden, so dass sie sich heute wirtschaftlich hoch über ihre russischen Nachbarn erheben.
Es ist erstaunlich, wie viel deutsche Sitte und Art bei diesen Siedlern erhalten blieb. Und ganz besonders erfreulich ist es, dass die deutsche Sprache sowohl in Schule wie Familie bis auf den heutigen Tag sich gegenüber dem Russischen zu behaupten gewusst hat. Selbstredend wird in den Gemeindeschulen, die von den Ortschaften auf eigene Kosten unterhalten werden – staatliche Schulen oder allgemeine Schulpflicht gibt es in Russland bekanntlich nicht - auch russisch gelehrt, jedoch beschränkt sich diese Sprache nur auf den Verkehr mit den ausschließlich russischen Dienstboten und Landarbeitern und selbstverständlich auf alle behördlichen Angelegenheiten. Daß dieses Deutsch mit etwas russischen Worten durchsetzt ist, ist ganz begreiflich, doch ist dies nicht einmal im weitergehenden Maß der Fall, als die deutsche Sprache in ihrer ureigenen Heimat unbegründeterweise mit Hunderten Fremdwörtern verunreinigt ist, die sich bei einigem guten Willen zum größten Teil durch gute deutsche Worte ersetzen ließen.
Wie ihre Sprache, so haben diese Deutschen, die fast ausnahmslos dem evangelischen Bekenntnis angehören, sich auch einen frommen, kirchlichen Sinn bewahrt. Allerdings ist auch der Aberglaube und der Mangel an Aufgeklärtheit über scheinbar übernatürliche Dinge, Hexen, Geister und Gespenster heute bei ihnen noch ebenso groß wie in ihrer früheren Heimat zur Zeit der Auswanderung und jedenfalls nicht viel kleiner als bei ihren russischen Landsleuten. Es belustigte mich, später einmal zu hören, dass sogar ich in den ersten Tagen, wenn ich in der Abenddämmerung von der Kirche heimging, wegen meines weißen Tropenanzuges bei besonders ängstlichen Vertreterinnen des schönen Geschlechts ein nicht zu kleines Gruseln verursacht hätte.
Die Kleidung der Leute weicht etwas von der unserer Landbewohner ab. Die Männer tragen das Hemd nicht unterhalb, sondern über der weiteren Kleidung, die im Sommer zwar nur aus Hose, Socken und Schuhen besteht. Es ist meist weißleinen mit einem rohseidenen, naturfarbenen Brusteinsatz. Das Gewand der Frauen ist ähnlich dem unserer einheimischen Bäuerinnen, nur etwas altmodischer. Eine ausgeprägte Volks –oder Landestracht besteht nicht. Im Sommer gehen die Kinder, der größte Teil der weiblichen Einwohnerschaft und sogar auch viele junge Männer barfuß.
Einige merkwürdige Züge zeigt das Familienleben der deutschen Bauern. Den Fremden wird zuerst die große Anzahl von Familienmitgliedern und unter diesen wiederum die der gleichaltrigen Kinder auffallen, welche zusammen unter einem Dach wohnen. Dies erklärt sich dadurch, dass eigentümlicherweise die die verheirateten Söhne das Haus nicht verlassen, und eine selbständige Haushaltung gründen, sondern nach wie vor im Haushalt der Eltern verbleiben, welch letztere ebenso wie vordem für deren Lebensbedürfnisse ebenso wie für die der mithereinziehenden Schwiegertochter nebst der er Ehe entsprießenden, meist nicht zu knappen Kinderschar zu sorgen haben. Die jungen Leute heiraten sehr früh, die Männer üblicherweise zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr, die Mädchen sogar schon mit dem 16 bis 17. Lebensjahr. Die Verlobungen finden häufig sogar schon so frühzeitig statt, damit gleich einige Tage nach Vollendung der gesetzlich als Mindestalter festgesetzten Grenze von 18 bzw. 16 Jahren ohne weiteren Zeitverlust gleich die Hochzeit erfolgen kann.
Es ist daher fast die Regel, dass die ihrer in Russland bekanntlich dreijährigen Militärpflicht genügenden jungen Männer, sowie auch Studenten, verheiratet sind, da ja ihre Familie während der Abwesenheit ebenso gut versorgt ist. Die Gesamtfamilien der einzelnen Familienväter sind daher auch dementsprechend groß. So zählte z. B. die meines freundlichen und ehrwürdigen Gastgebers ohne das zahlreiche Gesinde 25 Köpfe, als da sind: Die Eltern mit ihren jüngeren Kindern und drei verheiratete Söhne mit ihren Kindern. Die Art der Lebensführung wird auf diese Weise ungemein verbilligt. Die Wohnhäuser brauchen nicht einmal entsprechend größer zu sein, da jede der Zweigfamilien, selbst in recht wohlhabenden Häusern, nur ein einziges Zimmer als Schlafraum zur Verfügung hat. So wird in gemeinsamer Arbeit so viel erworben und für jeden der erübrigten Rubel neues Land angekauft, dass bei einer Teilung die auf die einzelnen Zweige entfallenden Landgebiete so groß bemessen werden können, dass jeder einzelne Sohn sofort ohne Sorge sich ein selbständiges Dasein gründen kann. Unter Umständen findet diese Aufteilung des Stammgutes noch gar nicht beim Tode des Stammvaters, sondern manchmal erst, wenn die Söhne schon selbst wieder verheiratete Söhne besitzen, so dass das Haus doch allmählich zu klein wird für so viele Leute.
Bezeichnend für den friedfertigen Charakter der deutschen Siedler ist, dass Zank und Streit innerhalb der Familie fast nie vorkommen. Doch wird aber auch von den alten Herrschaften eine strenge Zucht durchgeführt und insbesondere die Oberhoheit der Schwiegermutter wird von den Schwiegertöchtern bedingungslos anerkannt. Mit der Heirat bleibt man, auch aus Gründen der Zweckmäßigkeit und der Abrundung der Besitztümer meistens in der Verwandtschaft. Ehen von Geschwisterkindern sind nicht selten und man kann nicht sagen, dass hieraus schon nachteilige Folgen entstanden wären. Da man auch vorzieht, nicht nach außerhalb zu heiraten, ist so ziemlich die ganze Gemeinde unter sich verwandt. Ehen zwischen Deutschen und Russen kommen in diesen Kreisen äußerst selten vor.
Es lässt sich denken, dass die Stufe allgemeiner Bildung bei den Deutschen da hinten nicht gerade eine hohe ist, dazu sind die Siedlungen zu weit von der Welt abgelegen. Zeitungen werden nur wenige gelesen und in den meisten Häusern finden sich außer der Bibel keine Bücher. Eine Ausnahme bilden meist nur die Dorflehrer. Diese haben natürlicherweise ein etwas vielseitiges Amt. Sie verstehen es ebenso gut, ihrem kleinen Bauernwerk vorzustehen, wie den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Sie wissen mit Pferd und Wagen ebenso gut umzugehen wie mit Violine und Harmonium. Sie verstehen sich auf Bienenzucht wie auf Schweinezucht. Sie sind gewöhnliche Gemeindeschreiber und versehen zu guter Letzt auch noch dass geistliche Amt. Sie halten die Taufen und bestatten den müden Erdenwanderer zur letzten Ruhe. Sie lesen sonntags die Predigt in der kleinen, friedlichen Dorfkirche, denn der Pfarrer aus der großen Stadt kommt auf seinem Rundgang durch die deutschen Gemeinden vielleicht alle Vierteljahre einmal. Die Kenntnisse der übrigen älteren männlichen Einwohnerschaft reichen selten über die Grundlagen der Schulweisheit hinaus, doch wird dies beim heranwachsenden jüngeren Geschlecht sich nach und nach ändern, da der Wert vielseitiger Kenntnisse auch hier mehr und mehr erkannt wird und deshalb mancher kluge und strebsame Landmann einen seiner Söhne auf eine bessere Schule in die Stadt schickt oder ihm sogar das Hochschulstudium im In -oder Ausland ermöglicht. In unglaublicher, echt orientalischer Weise wird dagegen die Bildung des weiblichen Teils vernachlässigt.
Die Kenntnisse der Frauen und Mädchen beschränken sich lediglich auf Haushaltung und Landwirtschaft und es gibt Frauen, deren Männer über tausend oder tausende von Morgen (1Morgen = 3 ha) Land, vielleicht 100 Pferde und mehrere hundert Stück Vieh verfügen, also ein Millionenvermögen besitzen, die kaum das Notwendigste lesen und schreiben können. Die Frau nimmt auch nicht im Entferntesten die Stelle in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben ein wie bei uns oder auch mehr oder weniger im übrigen Russland. Sie ist sehr still, bescheiden, genügsam, ja sogar fast schüchtern zu nennen. Ihre Tätigkeit umfasst nur das Haus und das Wohl der Familie. Sogar die Musik, die auch hier sich großer Beliebtheit erfreut, liegt ganz in den Händen des starken Geschlechts. Und das Harmonium, welches sich fast in jedem größeren Bauernhof eingebürgert hat, wird ebenso wie das weit weniger volkstümliche und daher selten anzutreffende Klavier fast ausschließlich von einem Sohn des Hauses bearbeitet, der sich jedoch gewöhnlich nicht über den einfachen Choral oder den amerikanischen Gassenhauer oder Negertanz (!) hinaufschwingt. Andere Stücke bekommt man wenigstens nicht zu hören. Außer dem Harmonium ist der Phonograph sehr stark verbreitet, er jauchzt einem jeden Abend aus dem Fenster jedes zweiten Hauses entgegen, hie und da von einer Spieldose oder sonstiges Musikwerk abgelöst.
Die allgemeine Lebenshaltung ist dank dem gehobenen Wohlstand wenn auch einfach, doch gut und reichlich. Die Lebensmittel sind allerdings bedeutend billiger als bei uns. Man bezahlt z. B. für ein Pfund Fleisch etwa 25-30 Pf., ein Ei 2 Pf., Brot kostet 5-7 Pf. das Pfund. Verhältnismäßig billiger ist das Geflügel. Dazu liefert das nahe Meer Fische in großer Fülle und Auswahl. Man sieht also, daß man da hinten nicht Hunger zu leiden braucht, sondern dass man dabei sehr gut und dabei noch recht billig leben kann. Anfänglich vermißt der Fremde kühle Getränke etwas, denn es lässt sich denken, dass das Zisternenwasser nicht gerade sehr frisch ist, jedoch hat man sehr bald herausgefunden, daß bei der Hitze warme Getränke ohnehin viel besser und zweckdienlicher sind als kalte und hält sich dementsprechend an den Tee. Kaffee wird wenig gebraucht. Außerdem gibt es vorzügliche Milch im Überfluß.
Richtiges Bier sucht man vergeblich. Es wird zwar in Woronzowka an einer Stelle ein äußerlich bierähnliches Getränk in Flaschen verkauft, auch kühn „Bier“ genannt, aber ein Schluck und der Gast wendet sich mit Grausen.
Der deutsche Bauer verschmäht auch ein Schnäpschen keineswegs, besonders vor der Mahlzeit genehmigt er sich ein solches. Auch wenn man als Besucher ein Haus betritt, erscheint gleich der Schnapskolben, meistens ein verdünnter Aufguss des ohnehin sehr alkoholarmen russischen Wodkas auf Kirschen oder Beeren. Da er sehr harmlos ist, würde man ihn besser als einen Likör bezeichnen. Zur Melonenzeit, die gerade über die heißesten Monate dauert, ersetzen diese köstlichen Früchte jedes Getränk vollkommen.
Das Land ist, wie bereits erwähnt, sehr fruchtbar. Missernten kommen selten vor. Angebaut wird hauptsächlich Weizen. Die durchschnittlichen Ernteertägnisse sind etwa 14 Tschetwert Getreide von einer Desjatin. In besonders guten Jahren werden wohl auch 16 Tschetwert gewonnen. Ein Tschetwert sind 10 Pud. 1 Pud ist gleich ca. 40 deutsche Pfund. Eine Desjatin entspricht etwa zweieinhalb deutschen Morgen, also ein Ergebnis von 25 Zentnern Frucht pro Morgen (1 Morgen = 30 ha). Ich vermag nicht zu beurteilen, ob dies nach deutschem Maßstab viel ist, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass keine natürliche Düngung in unserem Sinn angewendet wird. Selbstverständlich werden auch Kartoffeln, dann etwas Mais und viel Gurken angebaut, welch letztere Russland bekanntlich noch mehr als in Deutschland als Nahrungsmittel geschätzt sind und meistens roh und nur mit etwas Salz verzehrt werden. Jedoch die Hauptrolle als Nahrungsmittel spielen von den Früchten die Melonen. Sowohl die Arbuse, die Zuckermelone, wie die Karwone, die Wassermelone, welche beiden Arten zur Zeit meines Aufenthaltes in der Reife standen. Sie wachsen an niedrigen pflanzen auf der Erde und werden in unabsehbaren Flächen gepflanzt. Beide erreichen ein Gewicht bis zu 20 Pfund. Beide Melonen werden in ungeheuren Mengen verbraucht, in jedem mittelgroßen Gutshof täglich etwa einen Leiterwagen voll. Allerdings entfällt davon ein Teil auf Vieh – und besonders auf Schweinefutter. Der süße Saft der Wassermelone wird auch eingekocht zu Brotaufstrich, Gebäckfüllung und Süßspeisen. An Obst gedeihen Kirschen, Birnen, weniger gut etwas Äpfel, Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche. Viel gezogen werden auch Kürbisse und Sonnenblumen, die letzteren ihrer Samenkerne wegen, die geröstet werden und die zu knabbern vom frühen Morgen bis späten Abend das Sonntagsvergnügen vieler Millionen Russen und auch Deutschrussen bildet. Eine größere Haushaltung verbraucht davon jährlich so ein halbes Dutzend Kornsäcke voll.
Die Größe der kleinen und mittleren Besitzungen bewegt sich etwa zwischen 200 und 500 Morgen. Unter den großen Gütern befinden sich aber auch welche mit 1 000 bis 3000 Morgen Land, jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass immer nur zwei Drittel der Gesamtfläche angebaut werden, während das andere Drittel ein Jahr lang brach liegen bleibt und als Viehweide benutzt wird. Dadurch geht die Düngung vor sich. Eine andere Düngung kennt man nicht und ich wurde ausgelacht, als ich erzählte, dass unsere Bauern wochenlang mit dem Güllenfaß und dem Mistwagen im Feld herumkutschieren. Dort ginge schon der großen Entfernungen nicht. Es versteht sich von selbst, dass mit dem Brachland jedes Jahr abgewechselt wird.
Der Wert des Landes hat im Laufe der Jahrzehnte sehr zugenommen, so dass es für den, der nicht schon viel Land besitzt, schwieriger geworden ist, in die Höhe zu kommen und sein Besitztum zu erweitern. Während noch vor 10 Jahren der Morgen 40 bis 50 Mark wert war, werden heute 250 bis 300 Mark bezahlt, was man für russische Verhältnisse schon als sehr viel bezeichnen muß.
Die Größe der Güter entspricht die Stärke des Viehbestandes. Ein Besitz an Pferden von 50 bis 100 Stück, an Hornvieh von 100 bis 200 Stück ist keine Ausnahme. Ein gutes Pferd ist etwa 300 bis 400 Mark wert, eine Kuh wird mit 180 bis 180 Mark, ein Schwein von durchschnittlichem Gewicht mit 20 bis 40 Mark gehandelt. Verhältnismäßig noch billiger sind Schafe und Lämmer, von welch letzteren ab und zu eins auf den Mittagstisch kam und bei der großen Zahl Esser auf einmal restlos verzehrt wurde.
Zur Zeit meiner Anwesenheit war die Ernte in vollem Gang. Außer seinem Haupthof hat jeder größere Gutsbesitzer noch einen kleinen Nebenhof, Chudor genannt, der durchschnittlich 5 bis 10 Kilometer vom Dorf entfernt in möglichster Nähe seines weit ausgedehnten Feldgebietes liegt und den Sommer über von einigen Familiemitgliedern, welche die Erntearbeiten überwachen, bewohnt und verwaltet wird.
Hier draußen spielt sich zur Erntezeit ein ganz gewaltiger Geschäftsbetrieb ab und eine Anzahl von Dampfdreschmaschinen, gewöhnlich Eigentum der reicheren Bauern, sind hier wochenlang in Betrieb. Dutzende von Pferden schleppen auf schlittenartigen, hölzernen Traggestellen die gelben Garbenbündel von den Stapelplätzen auf dem freien Feld heran und das abgedroschene Stroh wieder fort auf riesige Haufen oder vor die Dreschmaschinen, denn diese werden nur mit Stroh beheizt. Ihre Feuerung ist selbstverständlich zu diesem Behuf besonders eingerichtet, das heißt, mit einem riesengroßen Fassungsraum ausgestattet, in welchen ein Mann mit einer langen Gabel ununterbrochen Garbe um Garbe des prasselnden und knisternden Brennstoffs hineinschiebt. Dennoch erstaunte mich, dass man mit Stroh allein als Heizstoff für eine Dampfdreschmaschine auskommen kann. Noch verwunderlicher ist, dass sogar die Ziegeleien ebenfalls einzig und allein mit Stroh geheizt werden. Das Stroh, welches das für die genannten Zwecke oder zum Heizen der Zimmeröfen und des Kochherdes nicht verbraucht oder als Streu oder sonst wie verwendet wird, wird auf freiem Feld in großen Stößen als wertlos abgebrannt.
Nämlich infolge der bereits erwähnten Holzarmut dieses Teils Russlands wäre Holz als Brennstoff natürlich unerschwinglich teuer wegen der riesigen Herbeförderungskosten. Man musste daher auch für Kochherd und Zimmeröfen einen billigeren Ersatz finden und dafür erwies sich mit Stroh vermischter Stallmist als sehr geeignet. Dieser Heizstoff wird selbstverständlich zuvor zweckentsprechend vorbehandelt und umgewandelt, indem der frische Mist mit einer entsprechenden Menge kleingeschnittenen Strohs vermengt und auf einem umfriedeten Platz in etwa 10 cm dicker Schicht ausgebreitet wird. Nun lässt man einige Pferde ein paar Tage lang in der dicken, breiähnlichen Masse herumstampfen, bis sie sich vollkommen durcheinandergemischt hat. Nachdem die Masse ebengestrichen wurde, lässt man sie ein wenig abtrocknen, schneidet sie dann in Würfel und schichtet diese in Stößen zum vollständigen Austrocknen auf. Der fertige Stoff ist ganz ähnlich dem Torf, er entwickelt beim Brennen eine große Hitze und wenig Rauch und Asche. Infolge des Mangels an Holz und Kohle werden sogar die abgepflückten getrockneten Maiskolben als Brennstoff namentlich zur Heizung des „Samowars“, des Teekochers, verwendet.
Gewerbebetriebe findet man in den deutschen Ortschaften nicht, weil die deutschen Siedler sich nur in der Landwirtschaft betätigen, höchstens besitzt der eine oder andere eine kleine Ziegelei. Der Ziegelstein ist hier mangels irgendwelcher Natursteine der einzige in Betracht kommende Baustoff. Das Handwerk ist in der Regel durch einen Schuster, einen Schmied und einen Flickschneider vertreten. Die nötigste Handfertigkeit in Tischlerei, Zimmerei usw. besitzen die Bauern selber, wie ja natürlich jede Haushaltung auch ihr eigener Bäcker und Metzger ist. Für die sonstigen Bedürfnisse des täglichen Lebens sorgt der große Kaufladen des Orts, der sogar ein erstaunlich vielseitiges Lager an Kleiderstoffen, Haushaltungsgegenständen, Küchenbedarf, Gewürzen usw. aufweist. Da die ganze Gemeinde fast wie eine einzige Familie zusammenhält, so hilft über manche Verlegenheit, die das tägliche Leben so mit sich bringen kann, gegenseitige Anteilnahme und Hilfsbereitschaft hinweg.
Doch, meine Orgelaufstellung in Woronzowka war beendet und nach etwa zweiwöchigem Aufenthalt siedelte ich nach Ruhetal über, das von ersterem etwa 100 km entfernt ist und teils mittels Eisenbahn von Jeisk aus, teils mittels Fuhrwerk erreicht wird und nach etwa einwöchigem Aufenthalt daselbst noch nach Olgenfeld, wo ich ebenfalls ganz besonders freundlich und liebenswürdig bei Herrn Matthäus Michailowitsch Henne aufgenommen wurde, dessen einer Sohn kurze Zeit zuvor nach Deutschland gereist war, um dort zu studieren. Ich hätte ihn nach meiner Rückkehr gern besucht, um ihm die Grüße der Eltern und der ganzen Gemeinde zu übermitteln. Es gelang mir zu meinem Bedauern nicht, seinen Aufenthalt, angeblich in Darmstadt, zu ermitteln.
Die Beschreibung Woronzowkas und seiner Bewohner trifft ebenso für Ruhetal und Olgenfeld zu, wie überhaupt für alle Niederlassungen in diesem Teil Russlands. Sie gleichen sich bezüglich Lage, Umgebung und äußerlichem Ansehen wie ein Ei dem anderen, wie auch die Charaktereigenschaften, Sitten und Eigenarten der Bewohner überall dieselben sind. Von den drei Orten Woronzowka, Ruhetal und Olgenfeld ist letzterer der größte und reichste. Er hat etwa 800 Einwohner und besitzt außerhalb des Dorfes einige ganz einträgliche Obstanlagen und Weinfelder, für welche besondere Wächter aufgestellt sind, um Diebstählen durch die Bewohner der benachbarten Russendörfer nach Möglichkeit vorzubeugen. Mein freundlicher Gastgeber, Herr Henne, besaß außer einem der größten Güter des ganzen Gebiets auch eine neuzeitlich eingerichtete Mühle, die als einzige weit und breit sich eines großen Zuspruchs seitens der deutschen Landwirte erfreute.
Die Lage abseits von jedem Verkehr wird von den deutschen Siedlern nicht empfunden und als etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches in Kauf genommen. Daß die Eisenbahnstationen 20 bis30 km entfernt liegen, ist nicht allzu schlimm, da man ja nur selten, im Winter überhaupt nie verreist. Daß man zu Arzt und Apotheke ebenso weit hat, ist unter Umständen schon unangenehmer, insbesondere im Winter, wo ein Zusammentreffen mit Wölfen auf der einsamen Steppe draußen gefährlich werden kann. Für den vorübergehend anwesenden Fremden fällt am meisten ins Gewicht, daß die Postämter so schlecht erreichbar sind, wodurch der Verkehr mit der Heimat sich naturgemäß sehr erschwert. Z.B. die zu Woronzowka nächstliegende Postanstalt ist eben auch gerade das etwa 20 km entfernte Jeisk, der nächste Eisenbahnhalt. Für die deutschen Bauern, die vielleicht alle halbe Jahre einen Brief schreiben oder alle fünf Jahre oder überhaupt nie, hat dies wenig zu bedeuten, allein der Fremde wird diesen Mißstand mehr empfinden. Gewiß wird jeder, der zur Stadt fährt, gern bereit sein, angekommene Briefe mitzubringen oder einen Brief zur Post mitzunehmen. Jedoch ist mir wiederholt vorgekommen, daß der gute Mann den Brief schönstens vergaß und in der Tasche stecken ließ anstatt ihn mir zurückzugeben, so daß ich ihn durch jemand anderes besorgen lassen konnte, sich dachte, daß es in ein oder zwei Wochen, wenn er wieder in die Stadt käme, immer noch Zeit sei, den Brief in den Kasten zu werfen.
Der Begriff „Zeit“ hat dort eine andere Bedeutung als bei uns und man rechnet dort mit Wochen wie bei uns in Tagen. Die Losung “Zeit ist Geld“ ist da hinten noch völlig unbekannt und man merkt noch nichts von dem Hasten und Jagen unserer heutigen Gegenwart, von Parteistreit und Konkurrenzkampf. Eintracht, Ruhe und Frieden sind das Wahrzeichen dieser in der Vergangenheit untergetauchten, von der Gegenwart vergessenen deutschen Mitbrüder, welche bald seit eineinhalb Jahrhunderten fernab der Heimat ihrer Väter, fast ohne Verbindung mit derselben ihr Deutschtum bis zur Stunde fast unberührt in Ehren gehalten haben im Gegensatz zu den Millionen nach Amerika ausgewanderten Deutschen, die mit ganz verschwindenden Ausnahmen nach wenigen Jahren schon im Amerikanertum untergegangen sind. Und in ruhigem Gleichmaß fließen ihre Tage dahin, wenn dieses nicht durch russische Niedertracht oder gar verbrecherischer Gewalttätigkeit gestört wird. Vor allem ist die Gefahr räuberischer Überfälle von Seiten Angehöriger der umliegenden russischen Ortschaften nicht zu unterschätzen. Eine staatliche Obrigkeit gibt es in den deutschen Gemeinden nicht, der sogenannte Schulze des Dorfes ist lediglich eine von den Ortsbürgern gewählte rein örtliche Obrigkeit. Auch gibt es keine Polizei, die Gemeinden unterhalten nur einen oder einige Sicherheits - oder Nachtwächter auf eigene Kosten. Deshalb gehen die Räuber auch manchmal mit unerhörter Frechheit vor.
Es geschah z.B. in Olgenfeld kurze Zeit bevor ich hinkam, daß eines Abends eine Horde Räuber in ein Haus eindrang, die Bewohner ermordete und das Haus in aller Ruhe ausraubte, während ein Teil der Strolche die zu Hilfe eilenden Nachbarn abwehrte. Leider gelang es ihnen zu entkommen, bis auf einen, der von einem Schuß getroffen und später im Feld aufgefunden wurde. Auf die russische Polizei ist natürlich gar kein Verlaß. Es wurden wohl von der zuständigen Kreisstadt einige Polizisten entsandt und mit der Untersuchung beauftragt. Als sie jedoch auf der richtigen Fährte waren, zeigten sie /plötzlich kein Interesse mehr an der Sache und gaben die Nachforschungen auf. Selbstverständlich waren sie von den Verbrechern bestochen oder erhielten ihren Anteil an der Beute. Es bleibt daher in solchen Fällen nichts übrig als selbst Gericht zu üben, das heißt, wenn man die Spitzbuben erwischt, was auch schon ab und zu glückte, doch dürfen natürlich die Behörden davon nichts erfahren. Der beste Schutz sind schließlich noch die großen Hunde, von denen jeder Hof eine Anzahl hält. Sie sind ein notwendiges, wenn auch für den Fremden ein überaus lästiges Übel. Tagsüber machen sie sich weniger bemerkbar, wenn man jedoch nach Eintritt der Dunkelheit die Dorfstraße entlanggeht, kann des einem geschehen, daß aus noch nicht abgeschlossenen Höfen drei, vier oder noch mehr der riesigen Köter auf einen losstürzen. Die Hunde sind zwar außerhalb ihres Hofes nicht gerade gefährlich können aber einem recht unangenehm werden. Auch stören sie häufig die Nachtruhe durch stundenlanges, wütendes Gebell.
Früher wurden den deutschen Siedlern von der russischen Regierung allerlei, ihr wirtschaftliches Emporblühen fördernde und erleichternde Vergünstigungen gewährt, aber diese haben alle nach und nach aufgehört. Die Kaiserin Katharina II., bekanntlich eine deutsche Prinzessin, welche die Vorfahren unserer Landsleute damals zur Auswanderung nach Russland veranlaßt haben soll, unterstützte sie stets in jeder Hinsicht. Auch ihr Nachfolger, Kaiser Alexander I., war „seinen Deutschen“ immer überaus wohlgesinnt. Er soll einmal den Ausspruch getan haben: „Meine Deutschen sind meine treuesten Untertanen.“ Ihm verdankten sie auch das besondere Vorrecht der Befreiung vom Militärdienst auf die Dauer von hundert Jahren, das aber nun längst gefallen ist. Gerade zur Zeit meiner Anwesenheit mußten einige junge Männer einrücken, um ihrer Dienstpflicht zu genügen. Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß die Betreffenden, wie auch deren Familien darob sehr bekümmert waren. Da die ganzen Gemeinden wie eine einzige Familie sind, so nimmt alles am Geschick des Einzelnen regen Anteil. Die drei zogen denn auch von Haus zu Haus, um sich von jeder einzelnen Person unter Tränen und Küssen zu verabschieden. Schließlich ist ja auch der Militärdienst in Russland gerade kein Vergnügen, denn Ungerechtigkeit, Willkür, denkbar schlechteste Behandlung, ja sogar Mißhandlung von Soldaten sind sozusagen dass Normale und nicht gerade geeignet, Freude und Lust am Soldatenleben zu wecken.
Infolge der ungeheuren Entfernungen in dem riesigen russischen Reich, das bekanntlich fünfzig mal so groß ist wie Deutschland, wird es einem aus einer südrussischen deutschen Siedlung stammenden Soldaten, hauptsächlich aus zeitlichen Gründen, wohl kaum möglich sein, innerhalb der in Russland bekanntlich bei allen Waffengattungen dreijährigen Dienstzeit die Heimat wenigstens einmal zu besuchen. Allerdings liegt in Russland ein großer Unterschied gegenüber dem deutschen Militärwesen darin, daß der älteste Sohn, bew. der einzige Sohn nie zu dienen braucht. Ferner, daß, wenn vielleicht der zweite gerade seiner Dienstpflicht genügt, der dritte wieder frei bleibt. Je nach der Altersfolge der Vierte und erst wieder ein etwaiger Fünfter dran kommt. Mit anderen Worten, daß stets nur ein einziger Sohn aus ein und derselben Familie Soldat ist, niemals zwei oder mehr zur gleichen Zeit. Infolge seines gewaltigen Menschenreichtums hat Russland trotzdem die nötige Anzahl Soldaten und für den Kriegsfall stehen ihm ja diese unerschöpflichen Quellen zur Verfügung.
Es ist in Russland wohl selbstverständlich, daß mancher wohlhabende und bei den betreffenden maßgeblichen Stellen gut angeschriebene Militärdienstpflichtige sich durch Bestechung davon befreit, was dadurch erleichtert wird, daß die Untersuchung auf Tauglichkeit nicht durch besondere Militärärzte, sondern von dem nächsten zuständigen Kreisarzt vorgenommen wird, so daß Gelegenheit geboten ist, sich mit demselben zuvor in dieser Richtung ins Benehmen zu setzen. Nur darf kein Dritter durch einen unvorhergesehenen Zufall von dieser Sache etwas erfahren und sie zur Anzeige bringen. Sonst setzt es, sogar in Russland, mit Recht schwere Strafen.
Nicht nur die verschiedenen Vergünstigungen der Deutschen sind aufgehoben, ich vernehme auch sonstige Klagen darüber, daß die Zeiten nicht mehr so seien wie ehemals und insbesondere ihr Ansehen und ihre Wertschätzung bei den Behörden in den letzten Jahren gegenüber früher abgenommen habe. Es scheint, daß Neid und Mißgunst und daraus entspringende Verleumdung die Ursache hiervon sind. Schließlich ist dies, vom russischen Standpunkt aus betrachtet, ja begreiflich. Die Deutschen, die Fremden und immer Fremdgebliebenen, die durch ihren Fleiß, ihre Tatkraft und dank der ihnen früher gewährten Vorteile aller Art das Land ringsum ich ihren Besitz gebracht haben, sind sozusagen die Herren des Gebiets geworden, während die Russen, die Angestammten, arm blieben, ja sogar zum größten Teil bei den Deutschen in dienender Stellung sind. Ich habe mir oft die Mühe gemacht, diesem oder jenem mir Nahestehenden, wenn das Gespräch auf politische Dinge hinüberspielte, dringend zu empfehlen, einen Teil seiner Habe auf andere Weise sicher anzulegen und nicht aber auch alle und jede Ersparnisse auf Vergrößerung des Landbesitzes zu verwenden.
Ja, erwiderte man mir gewöhnlich, aber wie? Ich meinte darauf, auf einer guten Bank als sicheres Wertpapier und dergleichen, jedoch erhielt ich stets zur Antwort: „Ja, wenn wir sichere Banken hätten wie Sie in Deutschland und wenn es nicht die vielen Diebe und Räuber gebe, daß man ein paar tausend Rubel in den Kasten legen könnte, dann wäre es etwas anderes. Aber so wie die Dinge hier liegen, ist uns Grundbesitz am sichersten insofern, als man uns diesen nicht stehlen kann. Ich machte sie hierauf auf die Gefahr aufmerksam, die ihnen im Fall eines Krieges oder sonstiger Unruhen drohen könnte. Allein, es war ein vergebliches Bemühen. Ich selbst kann mich der Befürchtung nicht verschließen, daß es doch einmal so weit kommt, daß sich Rassenhaß und Mißgunst so weit vertiefen, daß die deutschen Siedler, wenn sie gerade auch nicht von Haus und Hof verjagt werden, so sich doch eine einschneidende Kürzung ihres Besitztums von obrigkeitswegen gefallen lassen müssen. Mag sein, daß ich etwas zu schwarz sehe, aber in Russland ist alles möglich. Hoffen und wünschen wir, daß ich nie Recht bekommen werde.
Alles zusammengefaßt, es hat mir sehr gut bei unseren deutschen Landsleuten gefallen, denn wahrlich sind es nicht die schlechtesten, die sich hier eine neue Heimat geschaffen haben, um welche sie Millionen in der alten Heimat beneiden könnten.
Stets werden Woronzowka, Ruhetal und Olgenfeld in meinen Reiseerinnerungen ein bevorzugtes Plätzchen einnehmen und ich möchte unseren lieben Landsleuten zum Abschied zurufen: Glückauf Ihr wackeren Schwaben!
Dieser Artikel erschien im Jahre 2003 in Band 3 „Russlanddeutsche Zeitgeschichte“, herausgegeben vom „Historischen Forschungsverein der Deutschen aus Russland“
Die Recherchen hierzu waren nicht einfach, die meisten der Orgelbaufirmen, die Orgeln nach Russland geliefert hatten, existieren nicht mehr und ich bin mir sicher, dass die Zahl von 83 in die deutschen Kolonistendörfer gelieferten Orgeln vollständig ist
Kirchenorgeln für Russland
Kurzgefaßte Geschichte der Orgel
„Königin der Instrumente“ wird sie genannt. Sie begleitet die Gläubigen in den Kirchen und Synagogen. In gewaltigen Ausmaßen findet man sie in vielen Konzertsälen der Welt. Berühmte Komponisten widmeten ihr hervorragende Werke und unzählige Künstler erlangten mit ihr Weltruhm.
Dabei ist die Orgel nicht nur „Königin der Instrumente“, sie ist zudem noch von allen Musikinstrumenten das am schwierigsten zu bauende und zu spielende. Es gibt Orgeln in einer Bandbreite von einigen hundert bis zu einigen tausend Pfeifen. (Die Orgel im Dom von Riga z.B. hat deren über 6 000, die größten Orgeln Europas in Breslau und Nürnberg hatten 16 000 Pfeifen) und es läßt sich leicht ausdenken, dass es nicht einfach ist, all diese Pfeifen, die manchmal die Ausmaße von Baumstämmen annehmen können, von den Tasten aus in Gang zu setzen und gleichzeitig mit dem nötigen Wind zu versorgen, der früher, als es noch keinen elektrischen Strom gab, durch einen von Menschenkraft betriebenen Blasebalg erzeugt werden musste.
Um diese unzähligen Pfeifen zu bedienen, bedurfte es mehr als nur einer Tastenreihe, wie wir sie vom Klavier her kennen. Bei der Orgel nennt man dies Manual und es gibt Orgeln mit bis zu fünf Manualen. Vor dem geistigen Auge stelle man sich fünf Pianos aufeinandergestellt vor und es wird kaum einen Artisten geben, der darauf gleichzeitig zu spielen imstande wäre. Orgelspieler sind solche Artisten, die mit ihren Händen gleichzeitig in die Tasten greifen und mit den Füßen die Pedale bedienen müssen. Und die Orgelbauer dürfen nicht vergessen werden, die mit einem dem Laien unvorstellbaren Gewirr von Verbindungen vom Manual zu den Pfeifen für einen reibungslosen Ablauf der Musikwiedergabe sorgen.
Bei solch einer Kompliziertheit liegt die Vermutung nahe, dass Orgeln erst in der Neuzeit erfunden wurden und eine rasante Entwicklung genommen hätten. Dem ist nicht so. So unglaublich es für einen Laien klingt, Orgeln gab es bereits im Altertum. Sie sollen etwa um 300 v. Chr. in Griechenland erfunden worden sein.
Wann in Rom die Orgel Einzug gehalten hat, ist nicht bekannt, wird aber von Cicero beschrieben und ab dem zweiten Jahrhundert n. Chr. war sie in der Oberschicht der Römer sehr verbreitet. Mit den heutigen Orgeln sind diese altertümlichen Orgeln allerdings nicht zu vergleichen, sie waren klein, transportabel und relativ einfach konstruiert.
Im westlichen Teil Europas läßt sich der Weg der Orgel während des ersten Jahrtausends n. Chr. nicht weiter verfolgen. In Byzanz, dem späteren Konstantinopel, das nach der Teilung des christlichen römischen Reiches Hauptstadt des oströmischen Reiches geworden war, lebte dagegen die Tradition des Orgelbaues weiter und wurde zu großer Blüte gebracht. Am byzantinischen Kaiserhof wurden aufwendige und sogar luxuriöse, in Gold und Diamanten gefaßte Orgeln als Zeichen der Macht verwendet und wertvolle Orgeln auch an andere Fürstenhöfe als Geschenk überreicht. So zum Beispiel überbrachte eine byzantische Gesandtschaft im Jahre 757 eine Orgel nach Frankreich als Geschenk und ebenso im Jahre 812 eine weitere Karl dem Großen in Aachen. Diese vormittelalterlichen Orgeln darf man nicht mit den heutigen vergleichen, deren Tasten mit den Fingern zu spielen sind. Zu damaliger Zeit hatten die Tasten Ausmaße von bis zu 10 cm Breite und einer Länge von bis zu 30 cm. Sie konnten nur mit Fäusten und Ellbogen bespielt werden.
Auf diesem Wege bekannt geworden, wurde zu damaliger Zeit in Europa die Orgelbaukunst in den Klöstern gepflegt und die ersten Kirchenorgeln sind sicheren Angaben zufolge in Augsburg (1060) in den Kirchen St. Ulrich und Afra erstellt worden, danach im Kloster Weltenburg an der Donau (1077). Ab dem 13. Jahrhundert setzte sich die Orgel als Kircheninstrument immer mehr durch und ist heute aus den Kirchen nicht mehr wegzudenken.
In immer mehr westeuropäischen Ländern entstanden Orgelbaufirmen, die repektable Kirchenorgeln herzustellen verstanden. So sind heute noch viele Orgeln aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhalten, obwohl nach der Reformation und der damit verbundenen Säkularisierung Orgeln zerstört wurden und für einige Zeit das Orgelspielen in den Kirchen verschiedener deutscher Länder verboten war.
Der Bedarf an Kirchenorgeln nahm ab Ende des 18. Jahrhunderts enorm zu, seit nicht nur in den Städten und Klöstern Orgeln aufgestellt wurden, sondern auch kleinere Pfarrkirchen sich Orgeln leisten konnten. Parallel hierzu entstanden, besonders auch in Deutschland, immer mehr Orgelbaufirmen. Einige von ihnen erlangten Weltruf, ihre Erzeugnisse waren rund um den Globus begehrt.
Als Beispiel hierfür soll die Firma E. F. Walcker aus Ludwigsburg dienen, die mit solider und innovativer Arbeit seit ihrer Gründung im Jahre 1830 über 6 000 Orgeln gebaut und in alle Welt geliefert hat. (USA 17, Argentinien 44, Polynesien 1, Japan 5, Australien 11 und Südafrika 55 sollen stellvertretend für viele andere Länder genannt werden).
Orgelkultur in Russland
Allein nach Russland lieferte die Firma Walcker 201 Orgeln und steht damit an der Spitze der Firmen, die in diesem Land Orgeln aufgestellt haben, gefolgt von der Firma Rieger, Jägerndorf (Sudetenland) mit 111 und Sauer, Frankfurt O. mit 74 Orgeln.
Die Orgelkultur Russlands begann, wie die Westeuropas, mit den Beziehungen des damals existierenden Kiewer Reiches zu Byzanz. An dessen Hof waren die Orgeln das wichtigste Musikinstrument und auch bei den russischen Fürsten waren sie als diplomatische Geschenke äußerst beliebt. Nach dem Untergang des Kiewer Reiches und mit dem Entstehen des großrussischen Reiches im 12. Jahrhundert mit der Hauptstadt Moskau und der Befreiung vom Joch der Goldenen Horde begannen die Beziehungen zu Westeuropa zu wachsen. Europäische Architekten, Wissenschaftler, Ärzte usw. wurden ins Land gerufen, Russland begann sich dem Westen zu öffnen. Im Zuge dieser Öffnung kam auch aus dieser Richtung die Orgelkunst, die allmählich in die katholische Kirche Einzug gehalten hatte, nach Russland. Allerdings gegen den Widerstand der orthodoxen Kirche, die den Gebrauch der Orgel, die in den Salons der Reichen und in besonderem Maße auch bei den Straßenmusikanten und auf Volksfesten weit verbreitet war, auf Äußerste verdammte und erreichte, dass in den orthodoxen Kirchen bis heute keine Orgel zu finden ist. Der Gottesdienst wird nur mit Gesang ohne jede andere Musikbegleitung zelebriert.
Am Zarenhof und bei den russischen Fürsten war die Orgel äußerst beliebt, ausländische Orgelbauer wurden ins Land gerufen und dienten als Lehrmeister, so dass sich im 17. Jahrhundert namhafte russische Orgelbauer etablieren konnten. Noch zu erwähnen wäre bei dieser möglichst kurz gehaltenen Beschreibung der Verbreitung der Orgel in Russland, die ein ganzes Buch füllen würde, dass die Orgel auch im russischen Heer Einzug gehalten hatte. Es liegen Berichte vor, dass sie bei Schlachten als Signalinstrument verwendet wurde. Sie war um viele Kilometer weiter und besser zu vernehmen als ein gewöhnliches Trompetensignal.
Die bei der Öffnung Russlands ins Land gerufenen ausländischen Fachleute aller Richtungen ließen sich in allen größeren Städten nieder, bildeten dort ihre eigenen Stadtteile, die sogenannten Slobodas und erhielten die Erlaubnis, ihre eigenen Kirchen zu bauen, was besonders zur Zeit Peters des Großen und in den Jahrhunderten danach der Fall war. Es waren vorwiegend lutherische Kirchen, die Mitte des 17. Jahrhunderts errichtet werden durften, waren von einfacher Bauart, meist aus Holz errichtet und hatten weder Glocken noch Orgeln. Erst 1695 wird die erste Kirchenorgel in der Moskauer Sloboda erwähnt, die in der ersten aus Stein gebauten Kirche aufgestellt wurde und 1697 lieferte der berühmte norddeutsche Orgelbauer Arp Schnitger eine von einem Herrn Ernhorn bestellte kleinere Orgel in die Moskauer Sloboda.
Im neu entstehenden St. Petersburg, an dessen Erbauung und Entwicklung namhafte ausländische, darunter auch recht viele deutsche Architekten und weitere Fachleute beteiligt waren, wurde gleich zu Beginn mit der Errichtung einer lutherischen Kirche der Anfang einer ganzen Reihe von christlichen Kirchen in Russland gemacht, die im Laufe des 18. Jahrhunderts gebaut werden sollten.
Es ist die Rede von der Peter - und Pauls - Kathedrale, die im Jahre 1728 fertiggestellt wurde und 1737 eine Orgel mit 1178 Pfeifen erhielt, erbaut von Johann Heinrich Joachim aus Mitau. Am 27. Dezember 1737 erklang sie zum ersten Mal mit einem Eröffnungskonzert vor einem großen Publikum, die Kirche faßte 1 500 Personen. Es war ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis und der Anfang einer ganzen Reihe von Orgelkonzerten namhafter Organisten in der weiteren Geschichte dieser Kathedrale. Wohl wurden während des 18. Jahrhunderts immer mehr christliche Kirchen gebaut, von Kirchenorgeln ist nicht viel die Rede.
Das sollte sich im 19. Jahrhundert ändern. Schon Mitte dieses Jahrhunderts existierten in ganz Russland 2 000 nichtorthodoxe Kirchen, viele von ihnen hatten eine Kirchenorgel. In den Firmenverzeichnissen der Orgelbauer Rieger, Sauer, Steinmeyer und Walcker finden sich neben Moskau und St. Petersburg Städte wie Archangelsk, Baku, Kiew, Odessa, Samara, Saratow, Tiflis u.v.a., in die Kirchenorgeln geliefert und aufgestellt wurden
Als Beispiel soll an dieser Stelle ein Bericht dienen, der Einblick in die Schwierigkeiten des Transports einer Orgel der Orgelbaufirma Walcker nach St. Petersburg gestattet, nebenbei aber auch Eindrücke über die sozialen Verhältnisse im alten Rußland vermittelt. Text stark gekürzt:
Die Orgel wurde 1836 bestellt, im Jahre 1840 in St. Petersburg abgeliefert und aufgebaut. Die Fahrt von Ludwigsburg nach St. Petersburg dauerte vom 1. Mai bis 30. Juni 1840. Diesen genauen Bericht über die beschwerliche Reise verdanken wir einem Gehilfen von Eberhard Friedrich Walcker, der in ausführlicher Weise seine Reiseeindrücke festhielt. Die Fahrt ging den Neckar abwärts zum Rhein und auf diesem bis Amsterdam, wo die wertvolle Fracht auf ein Segelschiff umgeladen wurde. Zuvor musste noch ein Transportschaden von 400 Gulden mit der Versicherung geregelt werden.
Am 11. Juni stach das Schiff in See. Schwere Stürme machten den Landratten aus Ludwigsburg zu schaffen, wurden dann wieder abgelöst von Windflauten, die ihnen eine große Geduldsprobe abverlangten.
Nach der Ankunft in St. Petersburg dauerte das Löschen der Ladung und der Transport der Orgelteile zur St. Petri - Kathedrale ganze drei Tage. Drastisch beschreibt der Berichterstatter die Arbeiter, die dabei helfen mussten: „Da hatten wir viel mit dem wüsten, unangenehmen Volk zu kämpfen. Voll Verwunderung mussten wir die Leute ansehen. Keiner ein gutes Hemd, noch weniger sonst was Gutes auf dem Leibe. In ihren Pelzen sitzt es voll mit Läusen, da zucken und reiben sie den ganzen Tag. Wenn sie Mittags Feierstunde haben, dann wird gegessen. Dies besteht in Schwarzbrot und rohen Zwiebeln, die Stengel haben, so lang wie ein Arm. Wenn sie sich dann recht voll gefressen haben, dann wirdder Pelz ausgezogen und gelaust, da kann man nicht wenige so russischer Kerls an der Börse sitzen sehen.“
Während der viermonatigen Aufbauarbeit der Orgel hatte er somit Gelegenheit genug, die krassen Gegensätze der russischen Gesellschaft kennenzulernen. Durch die Beziehungen des Prinzipals Walcker konnte er Einblick in die Gastfreundschaft vermögender russischer Familien bekommen, bei denen er reihum eingeladen wurde und deren Lebensweise er genau beschreibt. Er berichtet von Gesellschaften, Zechgelagen und Glücksspielen, die immer bis in den frühen Morgen andauerten. Die Menschen seien „ sehr arm an Geist und blind, da ihr Dichten und Trachten nur auf Sammeln von Schätzen und Betrügen des Nebenmenschen gerichtet sei“.
Zur Einweihung der Orgel am 1. November brannten 500 Wachskerzen und die Kirche war gedrängt voll. Von den Gehilfen bekam jeder außer Geldgeschenken als Anerkennung für gute Arbeit eine silberne Dose, E. F. Walcker einen silbernen Pokal. Die Heimreise dauerte 30 Tage, pünktlich zu Weihnachten, am 23. Dezember 1840, gelangte man nach abenteuerlicher Fahrt wohlbehalten in der Heimat an.
Die Firma E. F. Walcker war im Jahre 1830 in Ludwigsburg gegründet worden und die Orgel in St. Petersburg war die erste Orgel, die ins Ausland geliefert wurde. Sie hatte 3 Manuale, 65 Register und 3 780 Pfeifen, die größte war 10 Meter hoch. Sie ersetzte die weiter oben beschriebene Orgel aus dem Jahre 1737 und war die erste von 201 Orgeln, welche die Firma Walcker in den hundert Jahren bis zur Revolution nach Russland geliefert hat.
Im Jahre 1883 baute Walcker die Orgel für den Dom zu Riga. Sie wurde die zu ihrer Zeit größte und schönste Orgel der Welt mit 4 Manualen, 116 Registern und 6 768 Pfeifen. Die schönste ist sie bis heute geblieben. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Franz Liszt zu ihrer Einweihung seinen Orgelchoral „Nun danket alle Gott“ komponiert hat.
Interessant und erwähnenswert in diesem Rahmen ist die im Jahre 1904 von Walcker im Gynäkologischen Institut zu St. Petersburg aufgestellte Orgel. Zu jedem Krankenbett wurde eine Telefonleitung gelegt, so dass die Patienten . „...die Möglichkeit hatten, Musik zu genießen, während sie sich in den Betten befanden. Die strengen Krankenhausverhältnisse sollen gemildert werden, indem alles hineingebracht wird, was dem Patienten die Möglichkeit gibt, seine Gedanken zu zerstreuen und seine Stimmung aufzuhellen“. Auch der Wissenschaft sollte diese Orgel dienen: „... zur wissenschaftlichen Erforschung der Wirkung von Klangwellen und Musik auf Kranke und Operierte.“
Ortswechsel. In der Steppe Südrusslands und an der Wolga, fernab von den großen Städten, gab es kleine Dörfer mit manchmal wenigen hundert Einwohnern, die aber beachtliche Kirchen bauen ließen und in denen auch Orgeln nicht fehlen durften. Es sind dies die deutschen Kolonien in Südrussland und an der Wolga, die von deutschen Einwanderern gegründet worden waren. Es war die deutschstämmige Zarin Katharina II., die sie ins Land gerufen hatte. Im Jahre 1763 hatte sie das inzwischen berühmte Manifest erlassen, auf Grund der darin enthaltenen Privilegien und Versprechungen ausreisewillige Kolonisten im westlichen Ausland angeworben wurden, mit deren Hilfe sie die östlichen Grenzregionen an der Wolga besiedeln wollte. Vor allem in den deutschen Ländern hatten die ausgesandten Werber Erfolg und etwa 27 000 Menschen unternahmen die beschwerliche Reise in eine unbekannte Welt.
Dasselbe wiederholte sich am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1804 und dann wieder ab 1809 wurden von Zar Alexander I. wiederum ausländische, meist deutsche, Ansiedler geworben. Diesmal wurden sie in Neurussland angesiedelt, so nannte man das von den Türken in drei endlosen Kriegen zurückeroberte Gebiet am Schwarzen Meer, die heutige Ukraine. Auch Alexander hatte ein Manifest erlassen, das weitgehende Privilegien und Versprechungen enthielt, vor allem Befreiung vom Wehrdienst und freie Religionsausübung. 50 000 Menschen folgten daraufhin der Einladung durch den Enkel der Kaiserin Katharina II. und gründeten in der südrussischen Steppe ihre Dörfer, meist nach Konfessionen getrennt und in geschlossenen Siedlungsgebieten. Die meisten dieser Gebiete wurden in der Nähe der Hafenstadt Odessa angelegt, so dass der Versand ihrer Erzeugnisse gewährleistet war, der in den ersten Jahren der Ansiedlung mangels größerer Ernteerträge noch nicht möglich war. Es dauerte 50 Jahre oder zwei Generationen, bis sie durch harte Arbeit und nach vielen Rückschlägen und Mißernten einen beachtlichen Wohlstand erreicht hatten.
Weitere Siedlungsgebiete deutscher Kolonisten lagen im östlichen Teil der Ukraine, auf der Halbinsel Krim und selbst im Kaukasus wurden deutsche Dörfer angelegt. Alle diese deutschen Kolonien hatten ihre eigene Verwaltung in Form des „Fürsorgekomitees für deutsche Ansiedler in Südrussland“ mit Sitz in Odessa. Sie wählten ihre Schulzen und Oberschulzen aus ihren Reihen und hatten ihre eigenen Schulen, die Unterrichtssprache war deutsch.
Jesuiten, Missionare der Basler Mission und polnische Priester waren die ersten Geistlichen in der Anfangszeit der Kolonien und es dauerte gut zwei Jahrzehnte, bis Kolonistensöhne zu Pfarrern ausgebildet und eingesetzt werden konnten. Ebenso lange dauerte es, bis Kirchen gebaut werden konnten. Dann aber waren sie von stattlicher Größe und überragten ihre Dörfer, weithin sichtbar.
Es war aber nicht so, dass jedes Dorf seine Kirche hatte. Es wurden innerhalb der Siedlungsgebiete, die aus bis zu zwanzig, manchmal auch aus mehr Dörfern bestanden, meist vier oder fünf zu sogenannten Kirchspielen zusammengefaßt, mit dem Pfarrort als Mittelpunkt, der dem Kirchspiel auch den Namen gab. Hier wurden die Kirchen erbaut, überdies behielt jedes Dorf noch sein Bethaus.
Die Kirchen waren reich geschmückt. Die Altäre, Kanzeln und Heiligenstatuen waren zum größten Teil Holzschnitzereien aus Südtirol. Hauptlieferant war die Firma Stuflesser in St. Ulrich im Grödnertal. Finanziert wurde alles, auch die Kirchenorgeln, durch Spenden.
Insgesamt wurden in diese deutschen Kolonien in Russland 97 Orgeln geliefert, durchweg von deutschen oder österreichischen Firmen. Die folgende Aufstellung beruht auf Firmenprospekten und dem Anhang des Buches von Leonid Rojsman: „Die Orgel in der Geschichte der russischen Musikkultur“, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass diese Liste nicht vollständig sein kann, denn während der Revolutionsjahre in Russland wurden viele Kirchenarchive zerstört, aus denen zu ersehen gewesen wäre, von welchen, auch russischen Orgelbaufirmen, Kirchenorgeln geliefert worden waren.

Bach und Schugt,Stuttgart :
Friedenfeld (Tersanka) ev. St. Paul - Kirche
Elisabethgrad luth. Kirche
Nikolajew luth. Kirche
Neu – Glücksthal, Felsenburg
Gnadenthal, Christina
Franzfeld, Friedenfeld
Friedenstal, Elsaß
Grünental Krim (Karamin)
Engelmann |
|
|
Großliebenthal |
|
? |
| Gebr. Link, Giengen a. Brenz |
|
1904 |
| Olgenfeld (Tschebeljewka) |
|
1911 |
Michaelstal (Woronzowka)
|
|
|
| |
|
|
| Mauracher, Österreich: |
|
|
Blumenfeld |
kath. Kirche |
um 1900 |
| Rastatt |
kath. Kirche |
um 1900 |
| Alexandrowka, Krim |
|
1914 |
| Rieger, Jägerndorf |
|
|
| Kronau, |
ev. Kirche |
1896 |
| Eugenfeld |
ev. Kirche |
1896 |
| Michaelsfeld
(Kauk.) |
ev. Kirche |
1898 |
| Neustuttgart |
ev. Kirche |
1898 |
Prischib |
ev. Kirche |
1898 |
Gnadenfeld |
|
1898 |
Plotzk (Bess.) |
|
1898 |
Rosenfeld |
ev. Kirche |
1900 |
Lichtental |
|
1902 |
Neudorf |
|
1904 |
Neuburg |
|
1904 |
| Glücksthal |
|
1907 |
| Alt - Schwedendorf |
|
1909 |
| Schlangendorf |
|
1911 |
Dönhof (Gololobowka, Wolga ) |
|
1906 |
| Neudorf (Wolhynien) |
|
1904 |
| Halle (Alisowka, Bessarabien) |
|
1907 |
| Schäfer (Lipowka, Wolga) |
|
1905 |
| |
|
|
| Sauer, Frankfurt O.: |
|
|
| Alt - Arcis (Bessarabien) |
|
1880 |
| Marienfeld (Kaukasus) |
|
1889 |
| Cassel |
ev. Kirche |
1873 |
| Hoffnungsthal |
ev. Kirche |
1873 |
| Katharinenthal |
ev. Kirche |
1873 |
| Eichwald |
kath. Kirche |
1880 |
| Speyer |
kath. Kirche |
1880 |
| Rastatt |
kath. Kirche |
1880 |
| Landau |
kath. Kirche |
1882 |
| Kleinliebenthal |
kath. Kirche |
1887 |
| Göttland |
kath. Kirche |
1889 |
| Bettinger ((Baratajewka, Wolga) |
|
1872 |
| Schwed (Swonarewka, Wolga) |
|
1872 |
| Schöntal (Jagodnaa-Poljana Wolga) |
|
1872 |
| Preuss (Krasnopoli, Wolga) |
|
1873 |
| Kind (Bakakova, Wolga) |
|
1875 |
| Hussenbach (Linewo-Osero, Wolga) |
|
1886 |
| |
|
|
| Schupper, Österreich: |
|
|
| Mannheim
|
|
|
| |
|
|
| Steinmeyer, Oettingen: |
|
|
| Karlsruhe |
kath. Kirche |
1895 |
| Sulz |
kath. Kirche |
1896 |
| Nikolajew |
kath. Kirche |
1896 |
| Straßburg |
kath. Kirche |
1897 |
| Mannheim |
kath. Kirche |
1904 |
| Kischinew |
luth. Kirche |
1905 |
| Halbstadt |
kath. Kirche |
1906 |
| Baden |
kath. Kirche |
1907 |
| |
|
|
| Walcker, Ludwigsburg: |
|
|
| Borodino (Bess.) |
luth. Kirche |
1874 |
| Beresina (Bess.) |
luth. Kirche |
1891 |
| Fere - Champenoise 1. |
luth. Kirche |
1895 |
| Paris (Bess.) |
ev.-luth. Kirche |
1905 |
| Dennewitz (Bess.) |
luth. Kirche |
1906 |
| Katzbach (Bess.) |
luth. Kirche |
1907 |
| Fere-Champenoise 2. |
luth. Kirche |
1907 |
| Leipzig (Bess.) |
ev.-luth.
kath. Kirche Kirche |
1908 |
| Klöstitz (Bess.) |
luth. Kirche |
1907 |
| Hochstädt (Mol.) |
luth. Kirche |
1870 |
| Lustdorf |
luth. Kirche |
1870 |
| Neudorf |
luth. Kirche |
1870 |
Kandel |
kath. Kirche |
1898 |
| München |
kath. Kirche |
1899 |
| Freudenthal |
kath. Kirche |
1902 |
| Großliebenthal |
ev. Kirche |
1911 |
| Rosenfeld |
luth. Kirche |
1888 |
| Helenendorf |
luth. Kirche |
1875 |
| Elisabeththal |
luth. Kirche |
1895 |
| Grunau |
luth. Kirche |
1870 |
| Ludwigsthal |
luth. Kirche |
1874 |
| Neuhoffnung |
luth. Kirche |
1881 |
| Katharinenfeld |
luth. Kirche |
1902 |
| Annenfeld |
evang. Kirche |
1911 |
| Belowesch |
ev.- luth. Kirche |
1892 |
| Rosenheim (Podstepnaja, Wolga) |
|
1886 |
| Catarinenstadt (Wolga) |
|
1895 |
| Warenburg,(Privalnaja-Tarlikowka,W.) |
|
1898 |
| Kukkus (Wolskoje, Wolga) |
|
1911 |
| Rosenberg (Norka, Wolga) |
|
1891 |
Aus der Kolonie Mannheim, Kutschurganer Gebiet bei Odessa, stammt nachstehende Beschreibung der 1904 aufgestellten Orgel:
Neue Orgel
„Die von der Firma G. F. Steinmeyer u. Co in Oettingen am Ries, Bayern, der Kolonie Mannheim bei Odessa gelieferte neue Orgel ist dieser Tage fertiggestellt und Sonntag, den 19. September zum ersten Male gespielt worden. Die neue Orgel stellt sich nicht nur als der schönste Schmuck der Mannheimer Pfarrkirche, sondern auch das zur Zeit größte und feinste Orgelwerk Südrusslands dar, die Städte nicht ausgenommen. Vornehm und geschmackvoll präsentiert sich das mächtige und hohe Orgelgehäuse, die silberschimmernden Prospektpfeifen in einem Rahmen von natürlicher Eichenfarbe und edler Prunklosigkeit, gerade hierdurch den einfachen Verhältnissen der Kirche sich anpassend.
...Die Arbeit an sämtlichen Teilen der Orgel, auch an den nicht wesentlichen ist eine durchweg saubere und genaue, so dass die Orgel auch nach dieser Seite hin einen guten Eindruck macht. Einer der Chefs der Firma, Herr Ludwig Steinmeyer, überwachte selbst die Aufstellung der Orgel und besorgte die Intonation und Stimmung. Er war es auch, der der Pfarrgemeinde so günstige Zahlungsbedingungen einräumte, dass es jeder Gemeinde leicht werden dürfte, ein gutes, entsprechend großes und dauerhaftes Orgelwerk sich anzuschaffen und es bequem zu bezahlen, auch wenn gerade ein oder das andere schlechte Jahr einfällt. Und gerade bei so einem komplizierten Werke, wie eine Orgel es ist, hängt alles von der Solidität der Arbeit und nicht von der Billigkeit des Preises ab. Jedenfalls ist es empfehlenswert, dass jeder, der an die Anschaffung einer Orgel herantritt, sich erst die Mannheimer Orgel ansehe und sie sich innen und außen zeigen lasse.“
Die Firma Steinmeyer hat für diese vorliegende Arbeit aus ihrem Firmenarchiv nachstehenden Vertrag zur Verfügung gestellt. Dieses seltene Dokument soll hier stellvertretend für viele Orgelverträge in den deutschen Kolonien zum ersten Mal veröffentlicht werden:
Vertrag
G.F. Steinmeyer & Cie. Kgl. Bayr. Hof - Orgel u. Harmoniumfabrik, Oettingen und dem verehrl. Kath. Kirchenrath der Colonie Baden in Südrussland.
Betreff: Bau eines neuen Orgelwerkes in der kath. Kirche zu Baden.
G.F. Steinmeyer & Cie. verpflichten sich zum Bau der neuen Orgel nach Maßgabe ihrer Disposition und Kostenrechnung vom 10. November 1903 sowie beiliegender Zeichnung des Gehäuses zum Preis von Rubel 3 500 wörtl. Dreitausendfünfhundert Rubel.
Die Erbauer versprechen das neue Werk im Frühling 1907 an Ort und Stelle fertig zu übergeben und leisten für durchaus solide und dauerhafte Arbeit drei Jahre Garantie, von welcher jedoch ausgenommen sind diejenigen Störungen und schädliche Einflüsse welche ohne Verschulden der Erbauer z.B. durch höhere Gewalt, abnorme Temperaturverhältnisse, Staubanhäufung, Ungeziefer oder auch durch unvorsichtige oder mutwillige Beschädigung verursacht werden können.
Der verehrl. Kath. Kirchenrath Baden übernimmt folgende Gegenverpflichtungen: Er bezahlt der liefernden Firma die Summe von 3 500 Rubel folgenderweise: 1 000 Rubel bei Vertragsanschluß, 1 500 Rubel nach erfolgter Aufstellung, 1 000 Rubel innerhalb drei Jahren nach Übernahme des Werkes. Letztere Summe wird bis zur Tilgung mit 6% verzinst.
Die Übernahme des Werks erfolgt unmittelbar nach der Aufstellung und Gutbefund durch von dem löbl. Kirchenrath selbst bestellte Sachverständige.
Der verehrl. Kirchenrath bestreitet ferner auf eigene Rechnung den Transport vom Atelier an den Bestimmungsort sowie gesetzl. Zoll, stellt auch für die Dauer der Arbeit an Ort und
Stelle einen Handlanger bzw. Calcanten kostenfrei zur Verfügung und gewährt den die Aufstellung betätigenden Herrn während ihres Aufenthaltes dorten freie Kost und Wohnung.
Dieser doppelt ausgefertigte und beiderseits unterzeichnete Vertrag wurde für beide Teile als bindend erklärt und jedem Contrahenten ein Exemplar ausgehändigt
Oettingen und Colonie Baden den 10. Dezember 1906 G.F. Steinmeyer
B. Leibham, Pfarrer von Baden.
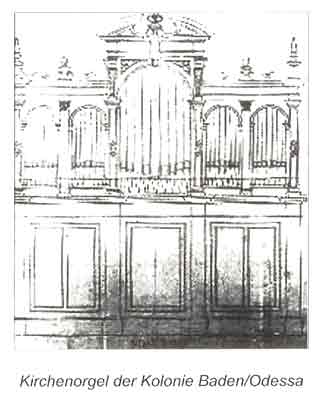
Dieser Bericht soll dem geneigten Leser einen kleinen Einblick in das tägliche Leben unserer Vorfahren in den deutschen Kolonien in Russland gewähren, weitere werden folgen. Es gibt noch viele unentdeckte Dokumente, die ihrer Entdeckung harren, sei es in den Archiven in der Ukraine, die wieder zugänglich sind oder in Veröffentlichungen bei uns in Deutschland, die nur einigen Eingeweihten vertraut sind und es die wert sind, einer breiteren Öffentlichkeit bekanntgemacht zu werden. Leider muss am Ende dieses Berichtes gesagt werden, dass von all den beschriebenen Kirchen in den deutschen Kolonien und damit auch von den Kirchenorgeln nicht eine einzige übriggeblieben ist .

Ein gottloses, unmenschliches und despotisches System, das 70 Jahre in Russland sein Unwesen trieb, hat wohl die Kirchen als äußeres Zeichen des Glaubens zerstört, den Glauben selbst jedoch im Innern der Menschen konnte es nie erreichen und beseitigen. Er ist wieder auferstanden in dem Land, in dem er unterdrückt war. Der Wiederaufbau von Kirchen, ob orthodox oder nichtorthodox, beweist es.
|
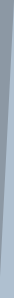 |